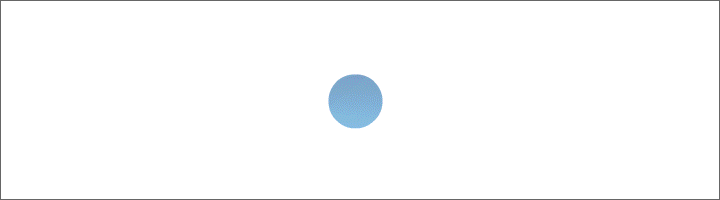Auszüge aus dem 1979 entstandenen Roman

Buchumschlag des 1979 im Mond-Buch Verlag Basel unter dem Pseudonym Georg Felix herausgegebenen Romans "Der Wirt vom Spalenberg" von Felix Feigenwinter.
Der Wirt vom Spalenberg
von Felix Feigenwinter
(.....)
Zweites Kapitel
Es war an einem Frühlingsmorgen. Die Strassen waren beflaggt, und zum erstenmal seit langem schien die Sonne. Ich stand auf einer Traminsel beim Bahnhof, müde und bettreif. Tags zuvor hatte ich an der Eröffnung der Frühjahrsmesse teilgenommen. Den ganzen Nachmittag war ich mit Kollegen durch die Messe gestreunt. Ich musste darüber schreiben - und abends waren wir in einem Nachtclub gelandet, wo wir uns stundenlang tummelten, fast bis zum Sonnenaufgang. So stand ich an jenem Morgen, nach einem Frühstück im Bahnhofsbuffet, wieder allein auf der Traminsel, abgeschlafft und trotzdem schon konzentriert auf die journalistische Aufgabe, die mich am Nachmittag erwarten würde: Ich musste meinen Messe-Bericht bis abends abliefern. Wären nicht zwei Fahrkarten-Kontrolleure gewesen, die ich plötzlich entdeckt hatte - ich hätte bestimmt den nun einfahrenden Tramzug bestiegen, um rasch nach Hause zu gelangen. Mein künftiges Leben hätte sich anders abgespielt...
Warum ich nicht jenes Tram bestiegen hatte? Ich erkannte wie gesagt die beiden in Zivilkleidern getarnten Billett-Kontrolleure, deren Gesichter mir als eifrigem Trambenützer längstens vertraut waren - da fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, rechtzeitig die neue Monats-Marke für mein Abonnement zu kaufen. Eine lapidare Sache... Das war mir schon mehrmals passiert: Ich gehörte nicht zu den Pünktlichen. Anderseits wollte ich meine Schluderei nicht leichtfertig ehrgeizigen Beamten ausliefern. Und ich scheute auch das Gaffen schadenfroher Trampassagiere, die nur darauf zu lauern schienen, vergessliche Mitfahrer zur eigenen Beruhigung als entlarvte Bürger zu feiern. Nun gut, ich hatte meinen Stolz und, zugegeben, auch eine mimosenhafte Empfindlichkeit. Eigentlich wäre das alles nicht der Rede wert - aber ich bin da doch wohl eine Erklärung schuldig. Kurz: Ich war zu matsch, als dass ich mich nach durchzechter Nacht auch noch nach einem Intermezzo in der geschilderten Art gesehnt hätte. Ich liess die Kontrolleure ohne mich abfahren, wartete auf das nächste Tram und überlegte, ob ich nicht lieber ein Taxi nehmen sollte - Taxichauffeure waren in der Regel Leute, die einen Uebermüdeten in Ruhe liessen. Da sah ich ihn zum erstenmal vor mir auftauchen.
Seine gedrungene, zwerghafte Gestalt fiel mir sofort auf: Er trug einen Koffer, wirkte fast ein wenig tragisch auf diesem festlich beflaggten Bahnhofplatz inmitten munterer Messebesucher ohne Gepäck. Und beinahe hätte ich noch sein Leben gerettet - was ich heute als besondere Ironie betrachten muss - ; aber das entpuppte sich als ein Missverständnis: Er betrat nämlich in dem Augenblick das Trassee, als sich von hinten ein schnell fahrender Tramzug näherte. In meinem Uebermüdungszustand hatte ich die Beherrschung verloren: "Aufpassen, ein Tram!" schrie ich ihm zu - meine Aufregung wäre unnötig gewesen: Der Zug glitt wegen einer nur während der Frühjahrsmesse üblichen Weichenstellung über die Schienen nebenan. Er war gar nicht gefährdet gewesen! Aber der Fremdling, der - wie er später oft genug beteuerte - an jenem Frühlingsmorgen zum erstenmal in Basel eintraf, dieser Zwerg hatte auf meinen Zuruf hin sein Gesicht tatsächlich in Richtung Tram gestreckt, hatte es gesehen und war trotzdem nicht von der Stelle gewichen, obwohl die Weichenstellung für ihn zu jenem Zeitpunkt ebenso wenig wie für mich klar sein konnte. Auch dafür gab und gibt es eigentlich keine vernünftige Erklärung.
Ich möchte nicht abschweifen. Ich will noch erklären, was mich an seiner Erscheinung besonders beeindruckt hatte. Da war, neben seiner Kleinheit, vor allem sein Gesicht, von dem eine bemerkenswerte Intensität ausging, die mich von Anfang an fesselte. Der Blick war schillernd, irgendwie aufgelöst, dann aber auch wieder unerwartet bohrend. Und da war sein stattlicher, dunkler Hut, der ihn älter und würdiger machte, als er in Wirklichkeit war, ausserdem natürlich grösser, aber gleichzeitig auch irgendwie lächerlich und dadurch mitleidheischend. Dass nicht nur er als tragisch zu bezeichnen war und ist, sondern ebenso sein Betrachter, der in sein Blickfeld geriet, ohne dass beide wissen konnten, wie ihnen geschah - diese Erkenntnis ging mir erst viel später auf. Aber da war es bereits zu spät. Doch ich will nicht vorgreifen.
Der kleine Mann steuerte auf meine Traminsel zu und liess seinen schweren Koffer vor meinen Füssen nieder. Sein grün-bläulich-grau schillernder Fischblick fixierte mich freundlich-lauernd, und irgendwie hatte ich den Eindruck, diesem Menschen schon irgendwo begegnet zu sein; aber wenn Sie mich fragen, wo, so kann ich es nicht sagen.
Mit einer Stimme, die mir sympathischer war als sein Blick, dessen Freundlichkeit ich nämlich von Anfang an beargwöhnte, ohne dass es mir damals schon bewusst gewesen wäre warum, behauptete er: "Sie kennen sich in Basel aus; können Sie mir sagen, wo ich in dieser Stadt möglichst schnell zu einer guten und billigen Wohnung komme?"
Der Mann sprach Berndeutsch, mit einem Akzent, der ins Französische griff; und da von mir in der Zeitung gerade eine Kolumne erschienen war, in der ich für fremdenfreundlicheres Verhalten der Einheimischen plädierte, antwortete ich spontan und heiter, soweit dies meine übernächtigte Verfassung zuliess:
"Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten schauen Sie sich die Inserate in einer Basler Zeitung an. Kommen Sie zu mir nach Hause - dann können Sie das in Ruhe durchsehen. Sie müssen entschuldigen, ich bin etwas übermüdet; ich habe in der letzten Nacht nicht geschlafen... Kommen Sie, wir nehmen ein Taxi!"
So kam ich doch noch zu meiner Taxifahrt, und knapp eine halbe Stunde später sass ich mit Paul Ignaz Brändli, so hiess mein unerwarteter Gast, kaffeetrinkend in der Wohnung. Dort gab ich ihm einen Stoss Zeitungen, um mich bald von ihm zu verabschieden - ich verkroch mich ins Bett. Als ich wenige Stunden später aufwachte, sass er noch immer an meinem Küchentisch und studierte Inseratenplantagen- seine Hartnäckigkeit war schon damals erstaunlich. Ich schlug ihm vor, bei dem schönen Wetter einen Spaziergang zu machen, er könne ja die Frühjahrsmesse besuchen; ich müsste jetzt meinen Zeitungsartikel schreiben, und wir könnten später, wenn ich damit fertig sei, zusammen essen gehen. Paul Ignaz war einverstanden.
Abends sass ich mit ihm im "Braunen Mutz", und ich versuchte, ihm auf den Zahn zu fühlen. Woher kam er, was wollte er in Basel, wieso diese irgendwie ziellose Ankunft - ohne eine konkrete Vorstellung über eine Wohnmöglichkeit? War Paul Ignaz verheiratet, hatte er Familienanhang, kannte er schon Leute in Basel? Was und wo wollte er arbeiten?
Es war herzlich wenig, was ich aus ihm herausbrachte. Irgendwie waren seine Erklärungen verschwommen - oder vielmehr ausschweifend und abschweifend; es schien mir, als ob er etwas verbergen wollte. Dabei erzählte er nicht etwa wenig. Vielmehr erging er sich in umständlichen, übrigens durchaus spannenden Schilderungen über einzelne Episoden aus seinem Leben, die aber wenig Zusammenhängendes ergaben. Ich musste annehmen, dass er bisher als Postbeamter irgendwo am Murtensee, wahrscheinlich in einer französischsprachigen Gemeinde, tätig gewesen sei; offenbar hatte er eine Freundin, oder er war verheiratet gewesen, aber durch einen tragischen Unglücksfall hatte er diesen Menschen verloren. Dann hatte er scheint's ein kleines Vermögen geerbt, das ihm jetzt ermöglichte, ein neues Leben zu beginnen. Es schien mir, als ob er ein Mann sei, der Vergessen suche - sich an einem ganz anderen Ort und unter ganz anderen Leuten eine neue Existenz aufzubauen versuchte. Da ich nicht aufdringlich sein wollte, bohrte ich vorerst nicht weiter. Ich dachte mir, dass er mir mit der Zeit, wenn wir uns besser kennen würden, schon noch mehr erzählen würde.
Drittes Kapitel
Nach einigen Tagen gab Paul Ignaz sein Bestreben, in der Zeitung nach einer Wohnung zu suchen, offensichtlich auf. Es blieb zwar vorerst unausgesprochen, aber alles deutete darauf hin, dass er sich in meiner Wohnung heimisch zu fühlen begann. Den Inhalt seines grossen Koffers hatte er aus- und in einen leerstehenden Kasten im Estrich geräumt. Ich bemühte mich, ihm zu verstehen zu geben, dass meine Einzimmerwohnung zu klein sei, um auf die Dauer zwei anspruchsvolle Individualisten zu beherbergen - wobei ich nicht nur auf meine oft nächtlichen journalistischen Schreibarbeiten hinwies, sondern beispielsweise auch auf die Besuche meiner Freundin, einer Musikstudentin. Zudem deutete ich an, dass der Hausbesitzer, und vielleicht sogar das Einwohneramt, Schwierigkeiten bereiten könnten; ich war davon überzeugt, dass es Paul Ignaz bisher unterlasse hatte, sich offiziell anzumelden, was für früher oder später Unannehmlichkeiten erwarten liess, da er sich ja offenbar in Basel anzusiedeln beabsichtigte. Er liess sich nun nicht mehr davon abbringen, sich bei mir einzunisten. Alsbald baute er eine Estrichecke mittels Pavadexplatten und eigenhändig gelegten elektrischen Leitungen in eine Wohnkammer aus, ohne mich oder den Hausbesitzer vorher zu verständigen. Die übrigen Mieter - alleinstehende Studenten, die nur vorübergehend hier wohnten - zeigten sich gleichgültig oder tolerant. Was sollte ich tun? (.....)
Sechstes Kapitel
Ich war an jenem Abend allein zu Hause. Silvia weilte an einem Konzert, und Paul Ignaz hatte einen seiner einsamen Spaziergänge unternommen. Es war ein linder Abend im Mai. Ich hatte einen Zeitungsartikel über einen jubilierenden Gesangsverein zu schreiben; eine harmlose Arbeit, die ich früher als erwartet beenden konnte. So sass ich plötzlich unbeschäftigt allein in meiner Wohnung, sah zum offenen Fenster auf den Spalenberg hinunter, wo sommerlich gekleidete Menschen vorbeiflanierten; ihre gedämpften und übermütigen Stimmen drangen verführerisch zu mir herauf. Es waren viele junge Leute in kleinen Scharen, dazwischen diskretere Liebespaare und ältere Menschen, darunter auch stille Einzelgänger. Auf einmal verdichtete sich der Menschenfluss; ich sah zum Teil festlich gekleidete Damen und Herren, ein gemischtes Publikum, das vermutlich aus dem Kellertheater unten am Spalenberg geströmt kam.
Ich überlegte, dass nun wohl auch das Konzert aus sein würde, das Silvia besucht hatte. Schon wollte ich mir die Schuhe anziehen, um Silvia beim Stadtcasino, wo das Konzert stattgefunden hatte, abzuholen. Doch dann stellte ich mir vor, dass sie vielleicht längstens auf dem Heimweg oder gar schon zuhause bei ihren Eltern sein würde; hatte sie mir nicht am Nachmittag am Telefon gesagt, dass sie sich heute besonders müde fühle und deshalb gleich nach dem Konzert früh schlafen gehen wollte? Also liess ich es bleiben. Wieder sah ich zum Fenster hinaus, an den schmalen, schiefen Hausfassaden hinunter, witterte die Frühlingsluft. Ich verspürte Lust, mich unter die Leute zu mischen, vielleicht im nahen Lokal ein Bier zu trinken, wo möglicherweise Bekannte sassen, mit denen ich mich hätte unterhalten können.
Aber nun fiel mir ein, dass Paul Ignaz' Estrichkammer leerstand. Brändli war wieder einmal ausgegangen, spazierte vermutlich am Rheinufer, und das brachte mich auf die Idee, hinaufzugehen, um mich in der Kammer umzusehen - nach jenen Indizien zu forschen, die uns bisher fehlten, um unsere Vermutungen über sein Vorleben zu erhärten. Ich zitterte vor Aufregung, als ich die Estrichtreppe hinaufschlich - die Situation war grotesk, schliesslich war es mein Estrich! Die Wohnungsmiete, die ich monatlich bezahlte, schloss seine Benützung ein, der Estricheingang war nur durch meine Wohnung zu erreichen, einen anderen Zugang gab es nicht. Und Brändli war ein Eindringling, der mir für seine Einquartierung keine Untermiete bezahlte. Was sollten also die Skrupel!
Und doch, die Tür zu seiner Kammer, die er auf einem Hausabbruch billig erstanden hatte, öffnete ich sehr vorsichtig, fast verstohlen - und ich erinnere mich, dass sie klemmte, an einem der Drähte hängenblieb, die im Estrich für das Aufhängen von Wäsche gespannt waren. Ich musste den Draht mit der Hand heben, damit ich die Tür überhaupt aufbrachte - es kam mir vor, als ob das Paul Ignaz absichtlich konstruiert hätte, um den Zugang zu seiner Kammer zu erschweren.
Das kleine Zimmer war den Umständen entsprechend gemütlich eingerichtet und ziemlich ordentlich aufgeräumt. Sogar ein Staubsauger lehnte in einer Ecke. Neben einem kleinen Schreibtisch mit Lampe stand ein Tischchen, auf dem der grosse, schwarze Hut lag, den Paul Ignaz bei seiner Ankunft in Basel anhatte, als ich ihn zum erstenmal gesehen hatte. Seither hatte er ihn nicht mehr getragen, ausser bei seiner Reise an den Murtensee vor einer Woche. Ich schnupperte am Hut - es schien mir, als ob er nach Weihrauch röche, aber vielleicht täuschte ich mich. Solche Hüte wurden in Hutläden kaum mehr angeboten; in Brockenhäusern mochten sie noch aufzutreiben sein, für wenig Geld. Daneben ein kleiner Plattenspieler, ein altmodisches, schlichtes Modell. Das Bett auffallend klein - ein Kinderbett? (Paul Ignaz mochte darin gerade Platz finden; für mich wäre es sicher zu klein gewesen, obwohl ich auch kein Riese bin.) Auf dem Nachttischchen sah ich das schwarze Mäppchen, das er oft bei sich trug, wenn er tagsüber in die Stadt ging. (.....)
Geräusche, ein Knarren, und dann undeutliche Stimmen, liessen mich zusammenschrecken. Das kam nicht von draussen durch die Dachluke, sondern aus dem Estrichinnern! Ob Paul Ignaz schon zurück war - so ungewöhnlich früh für seine Verhältnisse, es war noch lange nicht Mitternacht... Aber mit wem sollte er reden? War er so schrullig geworden, dass er lebhaft mit sich selber sprach? War es Silvia, die er vielleicht zufällig auf der Strasse getroffen hatte, als sie aus dem Konzert gekommen war? Wollte sie mich überraschen? Um aus der Kammer zu schleichen, war es zu spät. Unter allen Umständen wollte ich den Eindruck vermeiden, dass ich hier herumspionierte - wer immer das sein mochte.
Der Türspalt weitete sich, Paul Ignaz Brändli erschien im Rahmen, gefolgt von einer jüngeren Frau, die ich zum erstenmal sah. Seine Verblüffung war offensichtlich nicht kleiner als meine, und auch die Begleiterin schien verwundert. "Sie entschuldigen", sagte ich, "ich wollte da oben die Dachluke öffnen, es würde sonst zu schwül. Unerträglich, diese Hitze! Bis im Sommer muss das ja ein schöner Brutofen werden!"
Instinktiv hatte ich das Richtige gesagt; jetzt war er in die Defensive gedrängt. Sein mir aufgezwungenes Estrich-Logis war zur Diskussion gestellt - er musste sich rechtfertigen, nicht ich, der ich als rechtmässiger Mieter nur meine Pflicht tat.
"Ja, es ist stickig, ich muss wohl ausziehen, bevor der Sommer anbricht", antwortete Paul Ignaz bedächtig. Und dann, zu seiner Begleiterin: "Darf ich vorstellen... das ist Louis Wolf, mein Gastgeber. Und das ist Meret Wengeler, Gérantin von Beruf."
Ich verbeugte mich höflich und reichte Frau Wengeler die Hand, obwohl ich mich über den Unterton in Paul Ignaz' Vorstellung ärgerte. Was hiess da "Gastgeber"! Seine Generosität fand ich unangemessen - schliesslich war er ein ungebetener Gast, das wusste er doch genau... Aber dafür konnte Frau Wengeler nichts. Ich lud die beiden zu einem späten Imbiss in meine Wohnung ein. (...)
Siebtes Kapitel
Schnell erfüllte sich Paul Ignaz' Wunsch, ein Restaurant zu eröffnen, freilich nicht. Zwar besuchte er bald fleissig einen Kurs des Wirtevereins, und seine neue Freundin bot mit ihrer reichen Berufserfahrung Gewähr, dass das Unternehmen von Anfang an fachgerecht geplant werden konnte. Aber es gab einige Schwierigkeiten zu überwinden, zum Beispiel wegen der Lokalität. Paul Ignaz war in der ersten Juniwoche aus meinem Estrich in Meret Wengelers Wohnung umgezogen. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, die Gaststätte ins Zentrum der Altstadt zu legen, an den Spalenberg, ausgerechnet ins Erdgeschoss des Hauses, in dem ich wohnte. Er hatte offenbar schon Kontakte mit dem Hausbesitzer aufgenommen, und dieser stünde - so erklärte mir Brändli - dem Plan, das Parterre und möglicherweise auch das erste Stockwerk in einen Restaurationsbetrieb zu verwandeln, nicht ablehnend gegenüber. Wahrscheinlich rechnete der Mann sich aus, dass dann seine Probleme mit den Studenten, die im Haus bisher wie in einem Taubeschlag verkehrten, für immer gelöst seien. Da ich im obersten Stock gleich unter dem Estrich hauste, schien mich das nicht zu tangieren. Ich stand dem Projekt mit abwartendem und anfänglich durchaus wohlwollendem Interesse gegenüber - ja, ich bot Paul Ignaz an, mich ihm wenn nötig als Werbetexter und Ideenspender zur Verfügung zu stellen. Das Vorhaben, eine neue originelle Gaststube auf die Beine zu stellen, begann mich zu faszinieren.
Nur Silvlia zeigte sich zusehends misstrauischer. Sie hatte klare Vorstellungen von unserer Zukunft als dort am Spalenberg wohnende dreiköpfige Familie. Meine kleine Wohnung hätte dazu nicht ausgereicht, und deshalb fasste sie auch die darunterliegende Wohnung ins Auge. Sie wollte, dass ich deswegen mit dem Hausbesitzer rede. Doch das hatte ich immer wieder aufgeschoben, ich wollte nichts überstürzen. Zudem schien Silvias Plan mit jenem von Paul Ignaz durchaus zu vereinbaren zu sein - denn das Haus war dreistöckig, dazu kam das Erdgeschoss, in dem eine greise Modistin ihre Hüte verkaufte. Es war vorauszusehen, dass sie dies nicht mehr lange tun konnte. Sie war gebrechlich und kam vielleicht ins Altersheim. Auch wenn sich Paul Ignaz' Restaurant über zwei Etagen inklusive Parterre verteilt hätte, hätten wir uns immer noch unsere zweistöckige Wohnung einrichten können. Ich versuchte dies Silvia nahezulegen, doch sie blieb skeptisch. (...)
Neuntes Kapitel
Die Spannungen, die sich aus der Wohnungsgeschichte ergaben, wurden äusserlich überspielt. Es war geradezu grotesk, wie Paul Ignaz und ich unseren Bräuten gegenüber ungebrochene Eintracht demonstrierten – und es gab Augenblicke, da glaubte ich selber daran.
So weihte mich Paul Ignaz in gewisse Vorbereitungsarbeiten für die Lokaleröffnung ein. Er erzählte mir zum Beispiel, er würde andere Lokale studieren und mit anderen Wirten diskutieren, um die von ihnen gemachten Erfahrungen für seine Gaststube nutzbringend anzuwenden. Besonders schien ihn die Aktion eines Restaurateurs beeindruckt zu haben, der regelmässig einen Eintopf auftischen liess. Dieser erfreute sich in den Armee-Feldküchen seit langem einer grossen Beliebtheit. Die kräftige Fleischsuppe wurde in authentischen Militärgamellen serviert, ein Detail, das vor allem bei ehemaligen Militärdiensttauglichen älteren Semesters sentimentale Erinnerungen heraufzubeschwören schien. Jedenfalls sassen in jenem Lokal stets genüsslich mampfende graumelierte Herren, wobei der Anblick der ihnen vorgesetzten Gamellen sie besonders glücklich zu machen schien. Paul Ignaz war es nicht entgangen, dass diese treuherzige Bescherung für Militärküchen-Nostalgiker eine treue und dankbare Stammkundschaft sicherzustellen imstande war. Nicht, dass er diese Aktion kopieren wollte – die zum Teil verbeulten und arg verwitterten Gamellen (offenbar originale Exemplare, vermutlich authentisches Feldküchen-Geschirr aus den Aktivdienstzeiten während des zweiten Weltkriegs) auf den sauberen Tischtüchern hatte er doch unästhetisch empfunden, wie er mir gestand. Zudem sah er, vielleicht beeinflusst durch die Gérantin Meret, für sein zu gründendes Restaurant ein gemischtes Publikum vor, also auch Jugendliche, Hausfrauen und ganze Familien mit Kindern . Allzu Einseitiges wollte er vermeiden. Aber die Idee, mit einer bestimmten Atmosphäre und gewissen Attraktionen darauf ansprechende Gäste ins Lokal zu locken, wollte er aufgreifen und möglichst vielseitig anwenden. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass im neuen Restaurant kein Alkohol ausgeschenkt werden durfte – eine bedauerliche Einschränkung, wie Paul Ignaz fand, da seiner Meinung nach Feinschmecker zum Essen gerne Wein genehmigten. Die Brändli gaben die Hoffnung allerdings nicht auf, die Bewilligung für den Alkoholausschank irgendwann später doch noch zu erlangen. Vorläufig blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Gaststube alkoholfrei zu konzipieren. (...)
Ein Plakat, das ich beim Eingang zum Kellertheater unten am Spalenberg entdeckt hatte, inspirierte mich noch in jenem Herbst zu einer Idee, die Paul Ignaz sofort aufgriff. Das Plakat kündigte die Aufführung des Kindermärchens „Frau Holle“ an, und während ich kurz darauf in meiner Küche sass und mir eine Omelette zubereitete, hatte ich einen Einfall, der sich zwischen blödsinnigem Kitsch und kreativer Spielerei zu bewegen schien. Paul Ignaz war hell begeistert. Ich entwarf ein Kindermenü, das ich „Pfannkuchen Frau Holle“ nannte. Das Menü an sich war keinesfalls revolutionär: Es handelte sich um eine schlichte, mit Apfelschnitzen gefüllte und Zucker bestreute Omelette. Das Originelle war die Präsentierungsart: Ich stellte mir einen Keramikteller vor, an dessen hinterem Rand in einer runden Vertiefung eine in Ton geformte, bunt bemalte, ein Bettkissen ausschüttelnde Miniatur-Frau-Holle steckte. Der Zucker konnte aus dem von der Märchenfigur gehaltenen, als Zuckerbehälter konstruierten Kissen auf die Omelette gestreut werden. Paul Ignaz nannte mich ein Genie, nachdem ich ihm diesen Einfall geschildert hatte. Er bat mich, einen Keramiker ausfindig zum machen, der eine Serie der von mir entworfenen „Frau-Holle-Teller“ herstellen sollte, und zwar bis zum nächsten Frühjahr, spätestens bis kurz vor Fasnachtsbeginn. Bis dann wollte Paul Ignaz Frau Wengeler heiraten. (...) Brändlis Euphorie versuchte ich zu nutzen, indem ich ihn diskret daran erinnerte, dass bald auch ich heiraten würde und Silvia demnächst zu mir ins Haus am Spalenberg einziehen werde. Ich hoffte, er habe meinen Wink verstanden und war zuversichtlich, er würde sein Bemühen, uns die Wohnung wegzuschnappen, aufgeben aus Dankbarkeit für meinen Tip für den „Pfannkuchen Frau Holle“. (...)
(.....)
Fünfzehntes Kapitel
Ich kann mich nicht erinnern, einen eindrücklicheren Schnee-Einfall erlebt zu haben. Geschneit hatte es bereits anfangs November, während der Herbstmesse, was an sich schon aussergewöhnlich war.
Doch diese Bescherung war nach wenigen Stunden weggeschmolzen. Früh im Dezember gingen dann eine Nacht lang grosse, dicke Flocken nieder. Am Morgen brachen Baumäste unter dem Ballast ein, und auf den Strassen und Plätzen versank die städtische Verkehrsordnung im weichen, kalten Gewand. In den nächsten Tagen und Nächten schneite es weiter. Eine "Normalisierung der Lage", wie sich Behördemitglieder und Presseleute ausdrückten, war ausser Sicht. Am Spalenberg tummelten sich von Tag zu Tag grössere wintersportliche Scharen. Schlittelnde Kinder und Erwachsene in Skiausrüstung prägten das Strassenbild. Die "Spalenberg-Stube" erlebte einen ungeahnten Aufschwung. Es verging kein Nachmittag, an dem sich das Lokal nicht mit hungrigen Schlittelkindern und -familien gefüllt hätte. Mein "Pfannkuchen Frau Holle", inzwischen zum Hit unter den Kindermenüs in der ganzen Stadt aufgestiegen, fand reissenden Absatz. Während draussen mächtige Schneeflocken durch die Luft wirbelten, schüttelten drinnen Kinderchen den Zucker-Schnee aus den Frau Holle-Kissen auf die Pfannkuchen. Ich begann zu bedauern, dass ich auf Paul Ignaz' ursprüngliches Angebot, mich am Verkaufserlös des Pfannkuchen-Geschäfts zu beteiligen, nicht eingegangen war. (.....)
Bereits am Nachmittag des 24. Dezember kamen die Brändli in unsere Wohnung, um Vorbereitungen für das Festmahl zu treffen. Während die beiden Frauen in der Küche die Gans und die Beilagen präparierten, schmückten Paul Ignaz und ich den Weihnachtsbaum. Brändli zeigte sich in bester Laune. Nachdem der Baum in seiner vollen Pracht dastand, schleppte er erstaunlich grosse Weihnachtspakete aus der unteren Etage in unser Heim. Weil die Festgans bereits schmorte, zündeten wir auch schon die Kerzen an. Vor dem Essen galt es aber noch, den Wein zu holen. Paul Ignaz hatte darauf bestanden, für die Getränke selber besorgt zu sein. Da seine "Spalenberg-Stube" alkoholfrei geführt war, hielt er die Weinvorräte bei sich zuhause im Kleinbasel. Er bat mich, ihn dorthin zu begleiten. Fürs Festmahl habe er acht Flaschen gut gelagerten Pommard bereitgestellt. Bis wir zurück sein würden, würde die Gans sicher fertiggebraten sein, und das Fest könnte beginnen. Ich freute mich auf diesen Schmaus. Einen so gemütlichen Abend zusammen mit den Brändlis hätte ich mir vor wenigen Tagen noch gar nicht vorstellen können!
Wir waren bereits aus dem Haus, als Brändli noch einmal umkehrte, weil er in der Wohnung die Tramkarte und den Wohnungsschlüssel vergessen habe, wie er sagte. Es hatte wieder zu schneien begonnen, und bei diesem Wetter war eine Tramfahrt der Benützung des Autos vorzuziehen. Zusammen stapften wir den Spalenberg hinunter zum Marktplatz. Dort bestiegen wir das Tram, das uns zur anderen Rheinseite fuhr.
Durchs Schneegestöber gelangten wir zu Brändlis Wohnung. Die acht Flaschen Pommard lagerten auf dem Parkettboden; sie fühlten sich wohltemperiert an und funkelten im Schein des Stubenlichts. Brändli wickelte jede einzelne in Zeitungspapier ein und schichtete sie in eine Korbtasche. "Jetzt können wir gehen", meinte er dann. Seine Stimme bebte feierlich.
Wir tauchten wieder in den Winterabend. Weil uns auf der Clarastrasse ein Tram wegfuhr, entschlossen wir uns, den Weg zu Fuss zurückzulegen. Wir stapften, die Korbtasche gemeinsam an den Henkeln tragend, über den Claraplatz und durch die Greifengasse, näherten uns der Mittleren Brücke. Ein Gefühl behaglicher Vorfreude erfüllte mich. Bald würden wir zusammen in der Wohnung sitzen, zu viert die reich garnierte Gans und den Pommard geniessen, im Kerzenlicht eine Freundschaft besiegeln, die so lange Zeit in weite Ferne gerückt schien. Silvia und Meret würden das Festmahl schon angerichtet haben - unser Glück schien endlich eingebettet in eine harmonische Umgebung, nach der ich mich schon immer gesehnt hatte.
Paul Ignaz und ich schienen die einzigen zu sein, die zu dieser Stunde noch unterwegs waren. Die Familienfeiern mussten schon alle begonnen haben; ich hörte jauchzende Kinder, sah brennende Weihnachtsbäume. Wir schritten weiter, genossen schweigend den Anblick der schneeverhangenen Häusersilhouetten dem Grossbasler Ufer entlang; die Münstertürme schimmerten rötlich. Von irgendwoher, aus der Ferne, durchdrang eine Polizei- oder Feuerwehrsirene die Stille. Sonst aber war alles sanft, weihevoll friedlich, selbst das Knirschen unserer Stiefel im Schnee.
Noch als wir unten in den Spalenberg einbogen, war ich ahnungslos. Auch als Brändli zu schnuppern begann und sagte: "Da riecht's nach Brand!", verlor ich meine Zuversicht nicht. Behaglich lächelnd antwortete ich: "Weihnächtlicher Bescherungsduft!" Erst als ich eines der Feuerwehrautos in der Strasse stehen sah, davor eine dunkle Menschenansammlung, stutzte ich. Ein wildes Feuer züngelte in den Winterhimmel. Es drang aus dem Dachstock des Hauses, wo ich wohnte. Wir erlebten, wie das Gebälk in sich zusammenkrachte. Aus den Fensterlöchern meiner Wohnung stoben die Funken. Die "Spalenberg-Stube" versank im Löschwasser, die Verwüstung war nicht aufzuhalten.
Der Wirt vom Spalenberg - Fortsetzung
Sechzehntes Kapitel
Die Untersuchungen hatten ergeben, dass Silvia und Meret nicht die geringste Chance gehabt hätten, die Brandkatastrophe zu überleben. Das Feuer hatte offenbar zuerst den Weihnachtsbaum ergriffen, und noch bevor es die in der Küche hantierenden Frauen bemerkt hätten, sei das Benzin explodiert in dem unterm Weihnachtsbaum stehenden Kanister, der offenbar unzulänglich geschlossen gewesen sei. Dadurch habe sich das züngelnde Element, begünstigt auch durch den durchs zerschmetterte Fenster eindringenden Luftzug, unaufhaltsam ausgebreitet. Eine Flucht ins Treppenhaus sei ausgeschlossen gewesen, weil dieser Weg abgeschnitten gewesen sei. Die beiden verkohlten Leichen hatten Feuerwehrmänner an der Stelle gefunden, wo sich die Schwelle der Tür befand, die einst die Küche vom Wohnzimmer getrennt hatte. Auch die hölzerne Zwischenwand war vollständig ein Raub der Flammen geworden.
Erstaunt hatte den zuständigen Untersuchungsbeamten der Benzinkanister unterm Weihnachtsbaum. Paul Ignaz Brändli lieferte über diese in Geschenkpapier eingewickelt gewesene Explosionsursache eine ebenso verblüffende wie einleuchtende Erklärung. In meiner Verwirrung jener Tage bestätigte ich sie auf Nachfrage der Untersuchungsbehörde. Brändli hatte angegeben, dieses gewiss ausgefallene Geschenk sei als freundschaftlich-neckische Erinnerung an frühere gemeinschaftliche Autofahrten gedacht gewesen. Auf denen sei es, weil ich oft rechtzeitiges Benzintanken vergessen hätte, immer wieder zu unvorgesehenen Zwischenhalten gekommen. Diese Tatsache konnte ich nur bestätigen – ich fand es im ersten Moment, trotz den eingetretenen schrecklichen Umständen, geradezu schmeichelhaft, auf welch liebevoll-schelmische Weise Paul Ignaz meiner gedacht hatte. Den Benzinbehälter im Geschenkpapier wertete ich als eine rührende Versöhnungsgeste –denn unsere damaligen Ausfahrten in meinem kleinen Occasion-Wagen hatten uns allen schöne Stunden beschert. Nach der Missstimmung der letzten Monate und Wochen konnte eine Erinnerung an eine weiter zurückliegende, harmonische Zeit doch nur freundlich gemeint gewesen sein, dachte ich. So kam es, dass ich seine Angaben dem Untersuchungsbeamten gegenüber mit eigenen ausführlichen Informationen untermalte. Indem ich meine Fassungslosigkeit über die Brandkatastrophe mit den für mich höchst tragischen Folgen und meine wachsende Wut über die vermeintliche Tölpelhaftigkeit zu unterdrücken versuchte, half ich den Verdacht über ein unlauteres, gar verbrecherisches Verhalten ausräumen. Erst viel später wuchsen in mir Zweifel.
Unmittelbar nach dem Unglück hatte mir Brändli seine Wohnung, die früher Meret gehört hatte, angeboten. Ich war darüber vorerst dankbar, denn das ersparte mir Bittgänge bei anderen Bekannten oder Verwandten. Und eine Einquartierung in ein Hotelzimmer hätte ich damals als besonders trostlos empfunden.
Als Brändli an jenem kalten, frühen Morgen des Weihnachtstages die Tür zu Merets Schlafzimmer öffnete, das er mir zur Verfügung zu stellen angeboten hatte, sahen wir, dass Meret tags zuvor vergessen hatte, das elektrische Licht zu löschen. Die Lampe schien immer noch; Brändli knipste das Licht mit düsterem Schweigen aus. Die Trübnis, die uns plötzlich umfing, erschreckte und beelendete mich. Brändli verliess den Raum geräuschlos. Es schien mir damals, als ob ich in einen Traum geraten sei, aus dem ich nicht mehr erwachen könne. Die zwei folgenden Tage und Nächte verbrachte ich fast nur im Bett, aber ich blieb wach.
Auch am Tag der Bestattung von Silvia und Meret auf dem Friedhof wohnte ich noch bei Paul Ignaz. Nach den Beerdigungen befand ich mich am Rand des seelischen und körperlichen Zusammenbruchs. Ich hatte drei Nächte lang nicht mehr geschlafen. Die Vorgänge auf dem Friedhof hatten mir den Rest gegeben. Die Bestattungen wurden getrennt vollzogen, aber zeitlich zusammenhängend, so dass Trauergäste, die an beiden teilnehmen wollten, keine Zeit verloren. Natürlich waren auch Silvias und meine Eltern gekommen, alle mit tragisch-vorwurfsvollen Gesichtern. Mit Brändli schlich ich mich frühzeitig davon. Das Händeschütteln guter und weniger guter Bekannter und Verwandter hatte ich als Tortur empfunden. Ich war derart erschöpft, dass ich während der Taxifahrt nach Hause eindämmerte. Kaum hatte ich mich dann aufs Bett in Merets früherem Zimmer gelegt, schlief ich ein.
Als ich erwachte, vermutete ich, es sei am nächsten Morgen. In Wirklichkeit hatte ich eine Nacht und einen ganzen Tag geschlafen; es war schon wieder Abend, wie ich etwas später bemerken sollte. Im Bett liegend starrte ich zu den gelblichen Gardinen, dahinter auf einen verschneiten Hinterhof, schneebedeckte Dächer und zwei rauchende Kamine im Dämmerlicht. Ausser diesem traurigen Anblick irritierte mich ein Geräusch, aus dem ich zuerst nicht recht klug wurde, bis ich dahinter kam, dass es sich um den gedämpften Lärm von fliessendem Wasser handelte. Nachdem ich aus dem Bett gestiegen war und an der Badezimmertür im schmalen Vorraum gelauscht hatte, wusste ich es. Das Badezimmer war verschlossen; Brändli badete. Die Tür zu seinem Schlafzimmer dagegen stand offen. Ich betrat den Raum und nahm ein ziemliches Durcheinander von verstreuten Kleidern wahr; auch die Kastentür stand offen. Brändlis schwarzen Hut entdeckte ich auf einer Kommode am Fenster. Gedankenverloren ergriff ich ihn und drehte ihn in den Händen, während ich durchs Fenster in den Hinterhof sah, wo Kinder einen Schneemann bauten. Es war ein ungewöhnlich breitrandiger, hoher Hut, auch inwendig exklusiv verarbeitet, nämlich mit einem breiten, am oberen Saum festgenähten Band, das derart üppig gefüttert schien, dass es eine Art Kopfpolster bildete. An einer Stelle war die Naht des Bandsaums aufgerissen, mein Zeigefinger verirrte sich im Loch und blieb stecken. Ich machte eine seltsame Entdeckung: Unter diesem Band waren sorgfältig gefaltete Banknoten versteckt, ein geschickt getarntes Depot von vielen Dutzend Tausendernoten! Schnell legte ich den Hut zurück auf die Kommode; das war ein Geheimnis, das Brändli todsicher nicht preisgeben wollte. So ein Kauz – er bewahrte sein Vermögen statt zinstragend auf einer Bank in seinem grossen, alten Hut auf! Das erinnerte mich an Geschichten von misstrauischen Hutzelweibchen; sie gingen betteln, und nach ihrem Tod fand man unter ihren Matratzen einen alten Strumpf, in dem ein Vermögen unangetastet dahinmoderte. Eigentlich erstaunte mich das nicht; es passte zu diesem rätselhaften kleinen Mann, der nun so scheinheilig in der Badewanne planschte! Wie ärmlich er getan hatte, nachdem er nach Basel gekommen war und sich in meinem Estrich eingenistet hatte – gratis, versteht sich. Dass ich nun auch noch den auf dem Bett liegenden Kittel mit dem merkwürdigen Futter näher untersuchte, war eine Eingebung meines Instinkts. Ich stiess auch da auf ein leise raschelndes Banknotenlager. Brändli schien mit grösster Selbstverständlichkeit als wandelnder Tresor herumzugehen. Und noch etwas anderes entdeckte ich in diesem Kleidungsstück, in einer mit Reissverschluss verschlossenen gepolsterten Innentasche: einen Revolver! Ich schlich mich schnell in mein Zimmer zurück und verkroch mich in Merets Bett. Es hätte keinen Sinn gemacht, mich jetzt anzukleiden, denn zuerst wollte auch ich mich erfrischen.
Kurze Zeit später hörte ich ihn aus dem Badezimmer in seine Kammer gehen, und es verstrichen nur wenige Minuten, bis er ausgehbereit in mein Zimmer trat. Mein Wissen darum, dass er im Futter seines Kittels ein Vermögen steckte, dazu eine gefährliche Schusswaffe, stimmte mich fast ein wenig heiter.
„Ah, du bist wach? Ich dachte schon, du würdest auch noch die nächste Nacht durchschlafen“, begrüsste er mich. Er erklärte mir, dass er heute abend ins Kino gehe. Ich zeigte kleine Lust, ihn zu begleiten; so liess er mich allein an jenem Abend. Natürlich hatte er sein Zimmer wieder abgeschlossen, und sicher auch seinen Kasten, in dem jetzt wohl sein kostbarer Hut lag.
Nach einem Bad unternahm ich einen kurzen Spaziergang, dann legte ich mich wieder zu Bett und schlief ein, bevor Brändli zurückgekehrt war.
Am anderen Morgen studierte ich den Wohnungsanzeiger, um mir möglichst schnell ein eigenes Zimmer zu mieten. Ich hatte Glück; schon aufs Neujahr konnte ich als Untermieter zu einer AHV-Rentnerin ziehen. Das Zimmer befand sich oben am Spalenberg, nur ein paar Dutzend Schritte von meiner niedergebrannten Wohnung entfernt. Das war mir lieb, trotz der ständigen Erinnerung an die Katastrophe am Heiligen Abend. Dieses Altstadtquartier war mir ans Herz gewachsen, und ich war froh, Brändlis Wohnung entkommen zu sein. Die Nähe dieses Mannes konnte ich nicht mehr länger ertragen, obwohl er weder aufdringlich noch sonstwie nachweisbar eklig gewesen wäre. Aber aus seinem Verhalten konnte ich keine Zeichen der Trauer erfahren; das stiess mich ab. Ich hatte ihn ohne Streit verlassen. Merkwürdigerweise meldete er sich bei mir auch nicht mehr, und als ich ihn schliesslich doch einmal besuchen wollte, an einem Samstagnachmittag im Februar, stand seine Wohnung leer. Er war ausgezogen; die Wohnung war bereits an neue Mieter, ein junges Ehepaar, vergeben. Ich forschte noch ein wenig nach ihm, vergeblich; er schien sich aufgelöst zu haben. Obwohl mich das alles erstaunte, hatte ich vorerst nicht allzu viele Gedanken darüber verloren. Silvias Tod hatte mir arg zugesetzt; die Gefühle heftiger Trauer liessen vorerst keinen nüchternen Argwohn gegenüber Brändlis Verhalten zu. Erst als der Schock über die Brandkatastrophe allmählich nachgelassen hatte – und das dauerte Monate, ja Jahre! – begann ich, über Brändli kritisch nachzudenken. Wäre ich dazu früher fähig gewesen, wäre er vielleicht schon kurz nach dem Unglück verhaftet worden.
(.....)
Einundzwanzigstes Kapitel
(...) Die leuchtenden Farben des Baumlaubs versanken in den schleichenden Nebeln des hereinbrechenden Abends. Die sich am gegenüberliegenden Ufer bewegenden Spaziergänger und Radfahrer glichen Spukgestalten, und die dahinter stehenden Häuser waren kaum mehr zu erkennen. Ich wunderte mich, dass die St. Alban-Fähre, die zum bereits unsichtbaren Gasthof „Zum goldenen Sternen“ führte, immer noch verkehrte; der Fährmann würde wegen der sich schnell ausbreitenden schlechten Sicht wohl nur noch die drüben wartenden Leute holen und dann den Betrieb einstellen. Nachdem ich unter der Wettsteinbrücke durchgegangen war, sah ich, dass auch die Münsterfähre immer noch über den Strom glitt.
Unten auf dem Fährsteg bemerkte ich eine dunkle Gestalt, die ganz vorn am Wasser stand. Der kleine Mann, dessen Kopf ein auffallend grosser Hut zierte, hatte ein mit einem Tuch umwickeltes, fest verschnürtes kleines Paket ins Wasser geworfen. Jetzt sah er sich um.
Vielleicht hatte er meine raschelnden Schritte gehört. Oder wollte er sich vergewissern, dass ihn niemand beobachtet hatte? Paul Ignaz Brändli war aufgetaucht! Er hatte mich nur kurz ins Auge gefasst, dann senkte er das Gesicht, das vom grossen, schwarzen Hut nun gänzlich verdeckt war. Während ich die Treppe hinunterstieg, getrieben vom Verlangen, meinen bisher unfassbaren Widersacher zu stellen, kam mir Brändli gemessenen Schrittes entgegen. Beim Uferbord, unten an der Treppe, standen wir einander gegenüber.
„Guten Abend, Louis“, sagte Paul Ignaz. Seine Stimme verriet weder Ueberraschung noch Verlegenheit. Sie wirkte unantastbar feierlich, wie so oft bei früheren Begegnungen. Ich musste daran denken, dass Silvia diesen Zwerg früher für einen ehemaligen Priester gehalten hatte, und ich wunderte mich auch jetzt nicht darüber.
„Du hast ein Paket im Rhein versenkt“, versuchte ich ihn festzunageln. Dann hatte ich einen Einfall. „Ich denke“, sagte ich, „das war dein Revolver, den du all die Jahre auf dir getragen hast, unter deinem Kittel, den du auch im Sommer selten auszogst!“
Brändli bewahrte die Ruhe. Es schien ihm nicht daran gelegen, das Geheimnis zu vertuschen.
„Ich habe die Waffe versenkt, das stimmt“, bestätigte er, „ich benötige sie jetzt nicht mehr.“
„Wozu hast du sie gebraucht?“, fragte ich, erstaunt darüber, dass mir der Zwerg so bereitwillig Auskunft gab.
Brändlis Blick verweilte forschend auf meinem Gesicht, dann erwiderte er gelassen:
„Ich schleppte jahrelang mein Vermögen mit mir herum. Eine Belastung, die besondere Sicherheitsmassnahmen erforderte. Ich hatte mir dieses Geld, wie du inzwischen vielleicht auch schon herausgefunden hast, vor über dreissig Jahren bei einem Postraub angeeignet. Das war eine harte Sache, da war ich noch ein junger Mann. Die Waffe hatte ich schon damals benützt, um die Postbeamten einzuschüchtern. Ich hatte mich maskiert; ich ging keine unnötigen Risiken ein. Es war immerhin fast eine halbe Million. Und die habe ich mir sichergestellt. Kein Mensch hatte mich verdächtigt; ich blieb ein braver Bürger. Bis ich die Unvorsichtigkeit beging, zu heiraten. Meine erste Frau hatte mein vieles Geld und meine Waffe entdeckt. Sie wollte mich zwingen, das Geld der Post zurückzuerstatten, anonym, wie sie meinte. Sie war für mich das erste Sicherheitsrisiko. Sie verbrannte in unserer Wohnung am Murtensee, wo wir damals lebten.“
„Und dann kamst du nach Basel – und das Ganze wiederholte sich am Spalenberg“, folgerte ich schaudernd.
Brändli sah mich flimmernd an. „Ja“, sagte er feierlich, und er befeuchtete mit der Zungenspitze seine Lippen, „das Ganze wiederholte sich. Meret hatte die Sache ebenfalls herausgefunden, und sie liess nicht locker. Sie wollte mich dazu bewegen, mich der Polizei zu stellen. Damit hätte sie mich ins Gefängnis gebracht und unsere Spalenberg-Stube gefährdet, in die ich immerhin hunderttausend Franken gesteckt hatte.“
„Aber die Spalenberg-Stube wurde ja trotzdem zerstört, durch den Brand, den du legtest. Und du hast Frauen ermordet.“
„Ich hatte nur noch die Wahl, meine Freiheit zu retten“, fuhr Brändli unbeirrt fort; „Meret war wirklich unbelehrbar. Es war ihre Schuld, es hätte nicht so herauskommen müssen, wäre sie nur vernünftig gewesen.“
„Und Silvia?! Was hat sie dir getan? Du bist nicht nur habgierig, du bist ein eiskalter Mörder, ein Schwerverbrecher!“ Meine Stimme überschlug sich; sie war heiser und dunkel geworden. Mein alter Schmerz schrie aus mir heraus.
Aber die Ruhe hatte Brändli auch jetzt nicht verlassen. „Ich hatte gehört, dass Meret Silvia zuvor Andeutungen über den Brand vom Murtensee gemacht hatte – und über meinen Postraub. Ich hatte Meret davon erzählt, nachdem sie mich in die Zange genommen hatte. Da musste ich etwas unternehmen, ich konnte nicht länger zuwarten. Der Heilige Abend brachte die geeignete Gelegenheit.“
„Das wirst du büssen!“ stiess ich hervor.
Brändli schüttelte bedächtig den Kopf mit dem grossen Hut. „Zu spät“, lächelte er, und sein Gesicht nahm einen süffisanten Ausdruck an; „zu spät. Sowohl der Postraub als auch die Brände am Murtensee und vom Spalenberg sind verjährt. Unsere Strafrechtsordnung schützt mich, das muss dir jeder Experte bestätigen. Da ist nichts zu machen. Und was könntest du schon beweisen?“
Mittlerweile war die Fähre eingetroffen. Ein junges Paar entstieg ihr mit einem grossen, schwarzen Hund, der sich knurrend gegen Brändli wandte. Dieser erhob die Hand mit beschwörender Geste, so dass das Tier von ihm wich und die Treppe der Uferböschung hinaufflüchtete. Würdig schritt der Zwerg nun über den Steg und liess sich vom Fährmann auf das schwankende Lärchenholzboot helfen. Ich fühlte mich wie festgenagelt, war unfähig, dem Unhold zu folgen. Ich hielt ihn für einen Sadisten. Der Postraub mochte ihm selber als Alibi dienen; die wahren Mordmotive waren in anderen Triebregionen zu suchen, davon war ich überzeugt.
Jetzt sah ich, wie der Fährmann das Schiffchen vom Steg abstiess, den Schwengel umlegte und ins Boot zurückeilte, um das Steuerruder in Position zu bringen. Brändli thronte draussen auf der Fährbank, das Gesicht dem Münsterhügel zugewandt.
Ich starrte dem langsam wegschaukelnden Boot nach, bis es am anderen Ufer anlangte. Dann beobachtete ich, wie der kleine Mann das Schiff verliess. Bald sah ich nur noch den hohen, schwarzen Hut, der im Nebel versickerte. Ich hatte versucht, dem Zwerg mit den Augen zu folgen, als er die Treppen zur Pfalz hinaufstieg, zum Münsterhügel mit seinen vermoderten Gräbern.
Aber Paul Ignaz Brändli schien sich aufgelöst zu haben. Er entschwand in den grauen Schwaden, eine Nebelgestalt, die meine Vergangenheit mit sich trug.
____________________________________________________________________
Der Roman Der Wirt vom Spalenberg, aus dem hier Auszüge wiedergegeben sind, erschien 1979 im Mond-Buch Verlag, Basel, unter dem Pseudonym Georg Felix. Der Titel ist längst vergriffen. Das Copyright befindet sich beim Autor Felix Feigenwinter.
1981 wurde der Roman in der Basler AZ Abend-Zeitung als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht