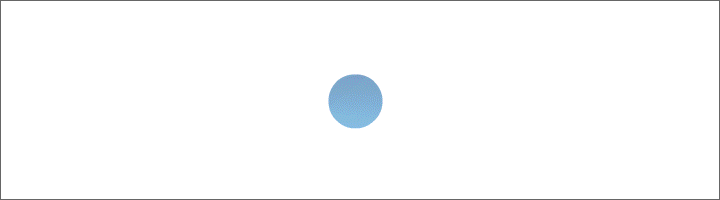"doppelstab" 1971
Drogenprobleme - "Schüttere Zukunft"
Von Felix Feigenwinter
Einige Leser warfen dem "doppelstab" vor: Indem er das Drogenproblem aufgreife, würden die Interessen einer schmarotzenden Minderheit aufgebauscht, die gar keine Beachtung verdiene. Kompetente Juristen, Ärzte und Politiker sind da anderer Meinung. Lic. iur. Bernhard Loeb, Chef des Betäubungsmittel-Dezernates der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, sagt, man müsse heute auch in Basel "von einer Drogenseuche" sprechen, und er hält die Aufklärung von Eltern und Jugendlichen für dringend nötig. Professor Dr. med. Paul Kielholz, Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Friedmatt, bezeichnet es als "unverantwortlich, die Gefahren des Haschischmissbrauchs zu bagatellisieren". Und in der vergangenen Woche bestätigte sogar Bundesrat Ludwig von Moos, es sei "Zeit, dass sich Parlament und Behörden sehr ernsthaft des Problems des steigenden Drogenkonsums annehmen".
Staatliches Monopol im Drogenhandel?
Nun beschäftigt das Drogenproblem auch die Eidgenössischen Räte in Bern. Am 3. Juni forderte Dr. Othmar Andermatt aus Zug in einem Postulat im Ständerat Straffreiheit für den Konsum von "weichen Drogen". Der Zuger regte an, es sei zu überlegen, ob der Staat sich nicht ein Monopol im Drogenhandel schaffen solle. Bundesrat von Moos erklärte sich namens des Bundesrats bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Die Idee der Straffreiheit für den Konsum von "weichen Drogen" und des Staatsmonopols für den Handel überging er zwar wortlos. Hingegen verwies er auf die neuesten Vorschläge der Betäubungsmittelkommission, die lauten:
Revision des Betäubungsmittelgesetzes mit dem Inhalt, den Konsum von Drogen leichter, und den Handel schärfer zu bestrafen.
Sechs Tage später, am 9. Juni, kamen dann auch die Nationalräte Ketterer (Zürich) und Deonna (Genf) auf das Drogenproblem zu sprechen. Ketterer zeigte sich beunruhigt über die "lawinenartig" zunehmende Zahl der Straffälle wegen Rauschgifthandels, und Deonna stellte fest, dass die Verbreitung der Rauschgifte "alarmierend" sei und dass das Bundesgesetz in dieser Beziehung Lücken aufweise. Er wollte wissen, wie weit die Expertenstudien über die Schliessung dieser Lücken gediehen seien. In seiner Antwort wiederholte von Moos das schon im Ständerat Gesagte und wartete ausserdem mit enthüllenden Zahlen auf:
Bereits 1969 seien in der Schweiz 521 Ermittlungsverfahren wegen Drogenkonsums und -handels eingeleitet worden, und 1970 sei diese Zahl sogar auf 2313 angestiegen. Vor zwei Jahren seien in diesem Zusammenhang 334 Verurteilungen ausgesprochen worden, 1970 deren 945.
Und in Basel?
Vergleicht man diese gesamtschweizerischen Zahlen mit der Statistik des Betäubungsmittel-Dezernats der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, so gewinnt man den Eindruck, dass gerade Basel punkto Drogenhandel und -konsum in der Schweiz eine auffallend hervorragende Rolle spielt.
Bei den im Jahr 1969 in der Schweiz aufgenommenen 521 Ermittlungsverfahren sind deren 411 vom baselstädtischen Rauschgift-Dezernat erfasste Fälle! 1970 hat sich das Verhältnis etwas verschoben - aber die Zahlen 2313 (Schweiz) und 667 (Basel) sind immer noch klar unverhältnismässig und zeigen, dass der Drogenhandel (und -konsum) in der Schweiz und ganz besonders im Grenzkanton Basel-Stadt in rasantem Anstieg begriffen ist. Rückschlüsse aus derartigen Zahlen sind insofern zu relativieren, als die Statistik unter Umständen mehr über die Tüchtigkeit bzw. Untätigkeit von Strafverfolgungsbehörden in den verschiedenen Kantonen Auskunft gibt als über das tatsächliche Ausmass von Drogenkriminalität und -Konsum. Dies ändert aber nichts an der alarmierenden Situation speziell in Basel.
Seit 11. Januar 1971 humanere Praxis
Die von Bundesrat von Moos in Aussicht gestellte mildere Behandlung für Drogenkonsumenten wird in Basel-Stadt schon heute praktiziert. In seinem Büro am Heuberg erzählt mir der Chef des baselstädtischen Betäubungsmittel-Dezernats, dass die hiesige Staatsanwaltschaft bereits am 31. August 1970 dem Regierungsrat beantragt hatte, für "geringfügige Fälle" das Verzeigungsverfahren einzuführen. Der Regierungsrat liess sich überzeugen. So werden seit dem 11. Januar 1971 erstmals in Basel-Stadt erwischte Drogenkonsumenten nach Abklärung des Tatbestandes nur noch verwarnt und statt einer Strafe der (ärztlichen oder/und sozialen) Fürsorge zugeführt.
Kranke, keine Kriminellen
Skeptiker argwöhnen, diese gelockerte Praxis sei nur eingeführt worden, weil das Betäubungsmittel-Dezernat die ins Uferlose anschwellende Rauschgiftkonsum-Welle nicht mehr habe bewältigen können. Lic. iur. Bernhard Loeb betont aber: "Wir sind selber zur Überzeugung gelangt, dass Drogenkonsumenten entgegen dem geltenden Recht nicht strafwürdig sind. Der reine Eigenkonsument wird von uns als kranker Mensch betrachtet, nicht als Krimineller". - Allerdings: "Den reinen Konsumenten gibt es kaum..."
Zusammenarbeit mit Psychiatern
Nach Bernhard Loeb sieht die Zukunft des Drogenproblems "schütter" aus: "Das Heroin ist in den Nachbarstädten angelangt: In Frankfurt, in Paris..." Seiner Meinung nach stellt sich der Strafverfolgung jetzt primär die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit anderen Rauschgiftdezernaten "den Grosshandel zu unterbinden". Bezüglich der Konsumenten, den Opfern dieses Grosshandels, arbeitet die Staatsanwaltschaft sehr eng mit der Psychiatrie zusammen. Der anzustrebende Grundsatz "Helfen und heilen statt strafen" scheint jedoch - trotz gutem Willen - schwer zu verwirklichen zu sein. Loeb: "Psychiater sagen uns, dass die Heilungschancen bei Drogensüchtigen um fünf Prozent herum liegen. Man müsste nach Vorbildern im Ausland besondere Drogenkliniken errichten. "In Amerika ist man da weiter." - Als einen Lichtblick deutet Loeb den Umstand, dass sich (nicht alle) jugendliche Konsumenten "auch als Opfer vorkommen" und daher bereit sind, mit der Staatsanwaltschaft und den Ärzten zusammenzuarbeiten: "Manche von ihnen stellen eigene Überlegungen an, was man machen könnte, um das Problem zu lösen".
Obligatorische Aufklärung von Eltern und Jugendlichen
Für unbedingt nötig hält der "Drogen-Staatsanwalt" die obligatorische Aufklärung von Eltern und Jugendlichen über das Drogenproblem; das "offene Gespräch von Eltern mit ihren Kindern" müsse gefördert werden. Und: "Man muss die Jungen davon überzeugen, dass diese Form des Lebens, die wir leben, Sinn macht."
Dass das Drogenproblem auch und vor allem ein soziologisches ist, scheint sich bei Fachleuten herumgesprochen zu haben. Bis die von der Entwicklung "überrumpelte" Politik die geeigneten Massnahmen ergreift und diese überall wirksam umgesetzt werden können, braucht seine Zeit. Verantwortungsvolle Idealisten versuchen schon heute, der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung durch privates Engagement gerecht zu werden. Vielversprechend ist die soeben ins Leben gerufene Basler "Vereinigung zu privater Selbsthilfe in Wohngemeinschaften". Sie "bezweckt, Mittel und Wege zu finden, um dem Jugendlichen in seiner Konfliktsituation auf eine den besonderen Verhältnissen angepasste Art zu helfen". Ausgehend von der Erfahrung, dass für viele Jugendliche weder das Heim noch die Pflegefamilie die geeignete Betreuungsmöglichkeit darstellt, möchte sie ein neues Modell des Zusammenlebens verwirklichen. Vorerst bildet ein junger Sozialarbeiter mit zwei oder drei Jugendlichen, die mit dem Problem vertraut sind, eine Wohngemeinschaft und erarbeitet die Voraussetzung für das Zusammenleben. Wenn Art und Form desselben gefunden sind, wird der Kontakt mit gefährdeten Jugendlichen aufgenommen und versucht, sie in die Wohngemeinschaft aufzunehmen und einzugliedern - wobei sie sich möglichst nach ihren eigenen, individuellen Tendenzen entfalten sollen.
Gegenwärtig sucht diese Vereinigung ein geeignetes Haus mit ungefähr zehn Zimmern in der Stadt oder Stadtnähe. Für die Planung haben sich namhafte Persönlichkeiten der staatlichen und privaten Fürsorge zur Verfügung gestellt, die sich in einem Patronatskomitee vereinigen.