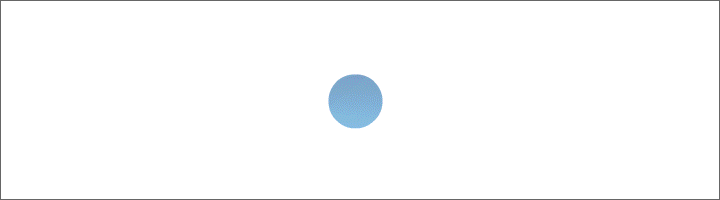„doppelstab“ 1977
Von der Schwierigkeit, Mundart zu reden
Von Felix Feigenwinter
Die Schwierigkeit, zu sprechen und zu schreiben, „wie einem der Schnabel gewachsen ist“, wird einem Deutschschweizer oft erst bewusst, wenn er in Kontakt mit bundesdeutschen Staatsbürgern kommt, die sich darüber wundern, wie schwer es uns oft fällt, uns der hochdeutschen Sprache zu bedienen. Der Hinweis darauf, dass Hochdeutsch für die meisten von uns eine Fremdsprache ist, in die wir das in unserem mehr oder weniger blumigen Dialekt Gedachte immer erst mühsam übersetzen müssen, mag in unserem von solchen Problemen ungetrübten deutschen Gegenüber amüsiertes Staunen oder, noch schlimmer, herzliches bis spöttisches Mitleid wecken. Ausgerechnet jene, die diese schwierige Klippe durch langjähriges Sprechenlernen und -üben des Hochdeutschen überwunden haben – nämlich ein paar fleissige Sprecherinnen und Sprecher des Deutschweizer Fernsehens und Radios - , geraten von Zeit zu Zeit immer wieder ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik und Diskussion. Erboste Hörerinnen und Hörer fordern von diesen Sprechpionieren in Schweizer Landen, sie mögen ihre mühsam erlernte perfekte hochdeutsche Aussprache zugunsten einer mehr an die schweizerischen Mundarten angelehnte Phonetik wieder ablegen. Ob sich da nicht auch jener Neid regt, der dem Besseren missgönnt, was eigenes Unvermögen (und sei's auch nur die Bequemlichkeit) nicht schafft?
Die Schwierigkeit, „zu reden, wie der Schnabel gewachsen ist“, kann allerdings sogar im Dialekt innerhalb des kleinen deutsch-schweizerischen Raums zu Komplikationen führen. Ich kann hier mein eigenes, relativ harmloses, weil auf den engen Raum der Region Basel beschränktes bescheidenes „Schicksal“ anführen: Als Kind eines Unterbaselbieters (Birseckers) und einer Stadtbaslerin, von der ich urbanes Baseldytsch als Muttersprache lernte, wuchs ich keine zwei Dutzend Kilometer von der Stadt Basel entfernt in einem Oberbaselbieter Ort auf. Dort heisst „sage“ (sagen) „säge“, „si hänn“ (sie haben) „si hei“, „Fänschter“ (Fenster) „Faischter“, „Wulgge“ (Wolken) „Wulche“. Während im städtischen Baseldytsch der Konsonant „r“ kehlig-französisch artikuliert wird, wird er von den ländlichen Oberbaselbietern mit der Zunge gerollt.
Dann kam ich zur Schule – in eben diesem Landschäftler Ort. Um nicht zu sehr als sprachlicher (und somit völliger) Aussenseiter gelten zu müssen, bemühte ich mich, den rauhen Oberbaselbieter Dialekt so gut wie möglich zu übernehmen – statt „Kind“ sagte ich „Chind“, statt „Kirsi“ (Kirschen) „Chiirssi“. Später besuchte ich das Gymnasium in Basel. Ein neuer, umgekehrter Anpassungsprozess wurde nötig: Als „Rammel“ (so die städtische Bezeichnung für die aus dem basellandschaftlichen Halbkanton Hergereisten), der nach der Vorstellung meiner Klassenkameraden wohl mit den Hühnern aufstehen musste, falls er den Morgenzug in die Stadt erwischen wollte, um rechtzeitig im Gymnasium zu erscheinen, und der manchmal zu spät kam, weil zwischen Frenkendorf und Pratteln eine Kuhherde das Geleise versperrte, wollte ich mich nicht auch noch sprachlich exponieren. Also entsann ich mich wieder meiner durch markige Oberbaselbieter Laute verschütteten städtischen Muttersprache – die ich so rein, wie ich sie als kleines Kind beherrschte, allerdings nie mehr sprechen konnte.
Als ich dann rund zwanzig Jahre später in Eigenschaft als Redaktor einer kleinen Regionalzeitung im aargauischen Freiamt nach Aarau fuhr, um dort einen aargauischen Regierungsrat zu interviewen, fragte ich im Gang des dortigen Regierungsgebäudes nach dem Büro des Gesuchten. Der von mir angesprochene Beamte sperrte Mund und Ohren auf – und strahlte mich ungläubig an, als ob ich ein bizarres exotisches Tier wäre: „Si-sind en Fricktaler – han-i recht?“ Resigniert lächelnd gab ich ihm recht. Besser, so sagte ich mir, dieser Aarauer hält mich für einen aargauischen Fricktaler, als dass er mich als das erkennt, was ich in sprachlicher Hinsicht offenbar bin: Eine mehr schlecht als recht geglückte Vereinigung von Stadt und Land Basel...