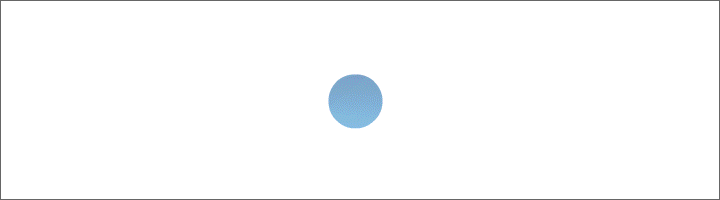Der Sohn und die Freundin
Von Felix Feigenwinter
Urs erinnerte sich, als kleines Kind den Vater von einer Publikumstribüne hinunter bestaunt zu haben, wie er in einem von Männern und Frauen bevölkerten Saal durch ein Mikrophon sprach. Da er nur mit einer dünnen, hohen, leisen und immer ein wenig belegten Stimme ausgestattet war, fehlte dem Vater die natürliche Möglichkeit zu kräftigen rhetorischen Auftritten. In freien Diskussionen rang er manchmal nach Atem und passenden Formulierungen. Er schob Verlegenheitsworte ein, um Pausen zu füllen, wiederholte oft dieselben Worte, was auf einen beschränkten Wortschatz oder jedenfalls auf eine langsame, etwas schwerfällige Denkweise schliessen liess, die in Gefühlen zu schweben schien. Oft versuchte der Vater mangelnden Scharfsinn hinter zynischen Bemerkungen zu verstecken, oder er hüllte sich in Schweigen, das arrogant, verlegen oder geheimnisvoll erschien, je nachdem, welchen Gesichtsausdruck er gerade zur Schau trug. Früher, als er noch jünger gewesen sei, habe er lebhafter und phantasievoller sprechen können, hatte die Mutter einmal behauptet. Nach verschiedenen Schicksalsschlägen und auch, weil er seine Kräfte unnötig verpufft habe, sei er inzwischen beinahe verstummt, aus Enttäuschung; seine Lebenslust sei dahin.
Je älter Urs wurde und je länger er über diesen Vater nachdachte, desto mehr erstaunte ihn dessen frühere Aktivität. Inzwischen war er ein alter Mensch geworden und längst pensioniert; seine einstigen Bekannten waren gestorben oder hatten ihn fallengelassen, und in den Jahren vor seiner Pensionierung hatte er ein ziemlich unbeachtetes und abgestandenes Dasein in einem Büro verbracht. Als Rentner lebte er nun zurückgezogen im ramponierten Haus seiner Frau, die, so glaubte Urs über seine Mutter zu wissen, den Schein ehelicher Eintracht zu wahren trachtete, den Vater aber nicht wirklich liebte.
Für Urs hatte der Vater eine sozusagen grossmütterliche Ausstrahlung; er verkörperte für ihn keine männliche Kraft. Vielleicht lag das auch daran, dass die Mutter im Familienkreis früher einmal spasseshalber erwähnt hatte, der Vater sei gar kein Mann, sondern eine getarnte Frau. Die Erinnerung daran hatte Urs später verwirrt; manchmal wünschte er, die Ehe der Eltern wäre geschieden geworden. Aber dazu war es jetzt wohl zu spät, und Urs war es schliesslich doch recht, dass er, der "ewige Student", im Elternhaus zwischen dem grossmütterlichen Vater und der väterlichen Mutter wohnen durfte, irgendwie beziehungslos im Schatten der Eltern. Trotzdem hatte er seiner Freundin mit dem Bekenntnis erschreckt, er könne sich nicht vorstellen, dass seine Eltern stürben; da würde er sich zu verlassen vorkommen.
Der sanften, leicht beschwipsten, aber auch klagenden Stimme ihres Geliebten hatte die Freundin unzählige Male am Telefonhörer gelauscht. Sie hatte sich nicht satthören können. Scheinbar munter hatte sie Urs aufgefordert, nach dem Ertönen des Piepstones ihre Botschaft zu hinterlassen, und sie hatte irgendetwas Zärtliches geflüstert, mehrmals täglich, denn der Geliebte machte sich rar, besuchte sie immer seltener in ihrer kleinen Mietwohnung, legte sich nur noch unter Vorbehalten zu ihr ins Nest: immer häufiger verkroch er sich in seinem Elternhaus, um sich zu "regenerieren", wie er es nannte. Dort gab er vor, sich seinen Studien zu widmen; in Wirklichkeit lag er verloren auf seinem Bett und hörte Musik, stundenlang Mozart, Thelonious Monk, Miles Davis oder den kräftigen Gesang einer schwarzen Bluessängerin.
Doch eines Abends ereignete sich etwas Ungewohntes. Nach einem unerträglich schwülen Sommertag durchbrauste ein herbstlicher Sturm die Stadt. Als die Freundin telefonierte, erschauderte sie: Urs hatte die vertraute Tonbandstimme ersetzt. Die neue Stimme hörte sich erschreckend abweisend an, unerbittlich streng (zu streng für den zarten, klagenden Jüngling), gleichzeitig tieftraurig, hoffnungslos düster. Und sie verschwamm in den Anfangsklängen zu Mozarts Requiem, die statt des Piepstons ertönten. Die Freundin erkannte die Aufnahme: Wie oft schon hatte sie diesem himmlischen Trauerkonzert innerlich bebend gelauscht! Nun glaubte sie die Fistelstimme von Urs' Vater zu vernehmen, der irgend etwas Weinerliches zu äussern schien (vielleicht beschwerte er sich darüber, dass sich der Abschluss von Urs' Studium immer noch nicht abzeichnete?). Hierauf durchdrang ein Schrei das Requiem. Die Antwort der Mutter galt wohl dem Vater, doch für die Freundin wirkte sie wie ein Befehl an ihre Adresse: "Lass' meinen Sohn endlich in Ruhe, du machst ihn unglücklich!"
Die Worte der Mutter erschütterten das aufgewühlte Gemüt der Freundin. Sie hatte Urs in der Universität aufgespürt. Zwischen den anderen Studenten, die entschlossen den Hörsälen zustrebten, entdeckte sie einen aparten Jüngling, dessen Sensibilität sie ergriff. Aber seine verletzte Seele war versponnen mit den unglücklichen Seelen seiner Eltern; woher sollte sie, die Freundin, die Kraft nehmen, sie zu erlösen?