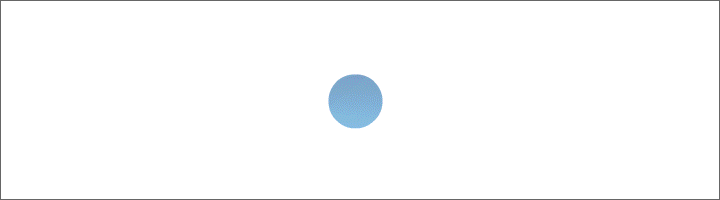Die dunkle Göttin
Von Felix Feigenwinter
Gestern abend war Willi Wolf, unter einem Gewölbe finsterer Gewitterwolken, den Rhein hinuntergeschwommen. Am Ufer, bei der Wettsteinbrücke, sammelten sich Einheimische und Durchreisende, die ein Stadtverein mit Getränken, gebratenen Fischen und volkstümlicher Musik zum Verweilen lockte. Diese sich auf einer kurzen Strecke des Rheinwegs Scharenden nahm er aus dem Fluss heraus kaum mehr wahr, ebenso wenig die Gebäudekulissen der Stadt und die Leute auf den Brücken, die ihm schattenhaft erschienen. In den unter dem wolkengeschwängerten Abendhimmel eingeschwärzten Fluten fühlte er sich im archaischen Element; das emsige, geordnete Menschentreiben am Rand des Wassers war schon weit weg.
Heute gleiten die Wellen dunkelgrün und noch lebhafter als gestern abend. Früher dachte Wolf, wegen der Biegung, die er beim Durchqueren der Stadt bildet, würde der Strom in seiner Wildheit gehemmt. Dieser Eindruck hat sich längst verflüchtigt. Seit sich Wolf selber in die Fluten stürzt, weiss er, dass die Stadt zwar fast alles Ungestüme, das sich in sie verirrt, zu bändigen, ja nicht selten zu vernichten oder mindestens auszuscheiden versteht - dem Strom dagegen ist sie nicht wirklich gewachsen. Sie ist ja auch viel jünger als er, und er würde sie vielleicht überleben. Manchmal denkt Wolf, er habe sie bereits überlebt - so sehr erscheint ihm die Stadt zuweilen museal, abgestorben, ausgetrocknet, ein Mausoleum.
Das nächtliche Gewitter hat die Hitze vertrieben; erst am späten Morgen lichtete sich die Wolkendecke. Jetzt ist es noch seltsam kühl für einen Sommertag. Wolf fällt die Begegnung von gestern abend an der Tramstation ein, wo er nach seinem Rheinschwimmen gewartet hatte, um heimzufahren. Eine dunkelhäutige Frau ging in einem langen weissen Gewand, mit einer Perücke auf dem Kopf, durch die dicht bevölkerte Abendstrasse. An der Tramhaltestelle blieb sie stehen, beglotzt von anderen Wartenden, bis die Gaffer wegen des hereinbrechenden Gewitters auseinanderstoben.
Bei der Münsterfähre bleibt Wolf stehen. Es zieht ihn heute nicht ins Wasser, aber er spürt das Bedürfnis, ans andere Ufer zu schaukeln. Er lehnt sich ans Geländer, schaut die Uferböschung entlang rheinabwärts.
Sein Blick bleibt an einer Figur haften, die ihn vorerst nur deshalb interessiert, weil sie sich von den anderen sonnenbadenden Menschen durch eine natürliche Anmut abhebt, die hier exotisch wirkt.
Es ist eine junge, dunkelhäutige Frau.
Irritiert sucht Wolf deren Körper ab, bemerkt die kecken Brüste unter dem kurzärmeligen Trikot, wundert sich über die langen Beine, die von hellblauen Jeans umspannt sind. Sein Blick bleibt an den Händen haften.
Dann schielt er auf die Gesichtssilhouette.
Es ist die dunkelhäutige Frau von gestern abend von der Tramstation, diesmal ohne Perücke, ungeschminkt, unverkleidet.
Gebannt bleibt er einige Minuten stehen, starrt auf diese Gestalt, eine lichte dunkle Göttin, lebendig und doch entrückt. Plötzlich hat er das Bild vor Augen: Fotos von Striptease-Tänzerinnen hinter einer Glasscheibe neben dem Eingang eines Nachtlokals, an dem er täglich vorbeigeht auf dem Weg zur Arbeit; Frauen aus Asien, Afrika und Lateinamerika, Importangebote aus Entwicklungsländern für den europäischen Erosmarkt.
Verstört eilt er den Rheinweg zurück.
Bei der Mittleren Brücke kehrt er um, hetzt wie ein Irrer wieder Richtung Fährsteg. Wie er mit fiebriger Ungeduld zu den breiten Treppenstufen an der Böschung hinspäht, kann er die Frau zunächst nicht mehr sehen. Dann erkennt er sie: sie hat sich auf eine der Stufen gesetzt, sonnt sich auf dem Rücken, platt auf dem harten Treppenbeton. Er schleicht sich zum Geländer, betrachtet sie vorsichtig. Wenige Meter unter ihm ruht sie: die mit weissen Schlappen bekleideten Füsse verschränkt, die gelben Socken umgeschlagen. Das Gesicht schlummernd, von der grellen Sonne beschienen.
Wolf reisst sich von der Andacht los, schleicht sich leise weg, ist immer noch nicht ganz sicher, ob er träumt oder wacht. Wie aus er Unterwelt steigt er die Treppe zur Mittleren Brücke empor, taumelt zur Tramstation, besteigt das Tram Richtung Grossbasel, starrt auf der Brücke zum Tramfenster hinaus Richtung Böschung vor dem Fährsteg und sieht: Die dunkle Frau hat sich wieder aufgerichtet, ist auferstanden, reckt die Arme in die Luft, hat den Schlaf beendet.
Hypnotisiert verlässt er bei der Schifflände das Tram, stürmt den Münsterberg hinauf, erreicht die Pfalz, wo er eine Zweifrankenmünze in den Schlitz des Fernsichtautomaten wirft, auf den Münzstift drückt, durchs Fernrohr das andere Ufer absucht.
Da sieht er sie wieder, vergrössert, scheinbar unmittelbar vor ihm sitzend.
Das Gesicht ganz nah, ihre majestätischen Bewegungen, eine in sich ruhende Statue, unheimlich jung.
Er fühlt sich als lächerliches, alterndes Männchen, versucht, sie sich älter vorzustellen. Es misslingt. Ein Gespenst? Nein, eine Sonnenpflanze, gestrandet in dieser mitteleuropäischen Stadt. Zu lebendig, zu echt für die gottverlassene Zivilisation. Nicht sie ist das Gespenst. Die Stadt ist gespenstisch, eine mittelalterliche Gruft, bewohnt von Vampiren, die sich mit fremdem Blut zu beleben versuchen. Wolf beobachtet, wie zwei badehosenbekleidete Typen, kränkelnde Bleichgesichter, ganz nah an der dunklen Frau vorbeischleichen. Sie beachtet sie nicht, sieht an ihnen vorbei aufs Wasser, blickt hinauf zum Münsterhügel, zu Wolf. Ob sie ihn sehen kann? Kaum. Sehen vielleicht, doch, das ist durchaus möglich. Aber erkennen? Nein.
Das Bild verschwindet. Wolf sucht vergeblich nach einem Zweifrankenstück. Die Zeit ist abgelaufen.
Erschienen im "Basler Stadtbuch" 1984 (Ausgabe 1985)