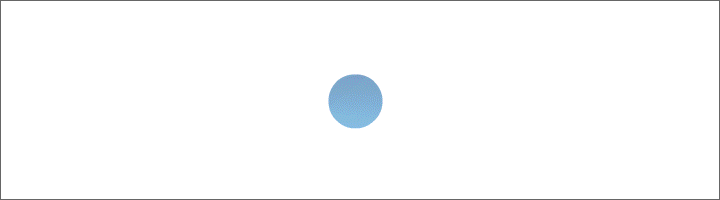Der Verrat
Von Felix Feigenwinter
"Die Sachlage ist die", versuchte Herr Krebs festzuhalten, und er räusperte sich in der Mitte des Satzes, der leider nichtssagend blieb. Er ließ seinen Eröffnungsworten entsprechend seiner Gewohnheit die ebenfalls überflüssige Bemerkung "nicht wahr" folgen, eine Umständlichkeit, die sein redegewandter Gesprächspartner, Dr. Peter Wolfer, sogleich zu seinem Vorteil auszunützen verstand. So wurde Herrn Krebsens Bemühung, eine seit Jahren unausgesprochene Problematik zur Sprache zu bringen, wieder einmal im Keime erstickt, umso mehr, als Dr. Wolfer seinem Gegenüber jetzt ein Kräuterbonbon anbot. Er fischte es mit gespreizten Fingern aus einem feingeflochtenen Körbchen, das sich auf dem etwas protzigen Präsidentenschreibtisch hinter den sich wild auftürmenden Aktenbergen wie etwas Fremdes, Frivoles versteckt hielt. Obwohl Herr Krebs Süßigkeiten sonst mied, bemühte er sich, der Geste seines Vorgesetzten gerecht zu werden, indem er das Bonbon beinahe feierlich in den Mund steckte. Vorsichtig lutschend schöpfte er, noch während ihn der Präsident mit einem blitzenden Redeschwall bombardierte, den Verdacht, sich versehentlich respektlos zu benehmen, da sich Dr. Wolfer doch vielleicht keinen Kanzlisten wünschte, der wichtige Anweisungen bonbonlutschend entgegennahm. Diese Vorstellung quälte ihn so sehr, dass er schließlich zum Gedanken Zuflucht nahm, Dr. Wolfer habe ihm möglicherweise das Bonbon angeboten in der Absicht, ihm damit den Mund zu stopfen.
Wenig später verließ Herr Krebs das Büro des Präsidenten korrekt, mit einer leichten Verbeugung (die Dr. Wolfer für lächerlich, wenngleich angemessen halten mochte), innerlich jedoch blutete er; sein frisch verwundeter Stolz, seine zerknirschte, in heillosem Groll bebende Seele verdunkelte seinen Gang zurück in die von einem grauen Montagmorgen fahl erleuchtete Kanzlei. Dort ging er eine Zeitlang stumm auf und ab, bis ihn das Schrillen des Telefons erschreckte. Innerlich immer noch bebend riss er den Hörer ans Ohr; er hörte eine Frauenstimme, es war Frau Wolfer, die Gattin des Präsidenten, die mit ihrem Mann sprechen wollte, wie oft schon hatte er diese Verbindung hergestellt, ohne seine wahren Gefühle zu offenbaren; zum erstenmal verstellte er sich nicht. "Ich kann nicht verbinden", schrie er mit anschwellender heiserer Stimme, "der Präsident ist tot. Ich habe ihn getötet". Jetzt war es ausgesprochen.
In die nun folgende furchtbare Stille drang sein eigener schwerer Atem aus der Hörmuschel, dann vernahm er wieder Frau Wolfers Stimme, die nun ebenfalls so angstvoll wie schneidend tönte: "Herr Krebs, sind sie in der Kanzlei?" Herr Krebs antwortete tonlos: "Er ist tot. Ich habe ihn umgebracht. Soeben."
Hierauf legte er den Hörer zurück auf den Apparat und setzte sich an sein Arbeitspult. Er sah auf die Kanzleiwand, wo früher Gerichtswitze hingen, aus Zeitungen ausgeschnitten, die sein längst pensionierter Vorgänger gesammelt und aufgehängt hatte. Dr. Wolfer hatte ihre Beseitigung verfügt, da in einem öffentlich zugänglichen Amtsraum, wie er erklärte, keine Karikaturen zu dulden seien. So blieb als einzige Belebung an der Wand ein Gemälde, eine Leihgabe des kantonalen Kunstkredits, wie die Aufschrift auf dem Schild am Rahmen des Werks verriet. In der ersten Zeit seines Kanzleidaseins hatte Herr Krebs befürchtet, das Bild würde ihm entführt, etwa im Zusammenhang mit einer Museumseröffnung, oder weil ein hoher Chefbeamter die Gabe im eigenen Büro aufgehängt wissen mochte. Mit den Jahren lernte er, diese Angst zu bezähmen. Das Bild war mittlerweile Bestandteil seiner Seele geworden; es begleitete ihn über Mittag, wenn er in einem kleinen Restaurant in der Nähe einen Imbiss zu sich nahm, und abends in seine Junggesellenwohnung am Stadtrand. Die freien Wochenübergänge und die Ferien verbrachte er selten auswärts, da er sich in der Stadt wie ein Fötus eingenistet hatte. Jede Verpflanzung, auch nur eine vorübergehende, gefährdete sein Gleichgewicht. Die Kanzlei im Stadtzentrum war zu einem Tabernakel geworden; schon in seiner eigenen Wohnung an der Peripherie fühlte er sich wie abgeschoben, verloren. Unauffälliger Kontakt zu Andrea, der Gattin des Präsidenten, war ohnehin nur in der Kanzlei möglich, durchs Telefon, wo er die Stimme dieser wunderbaren Frau, die er mit den Jahren wie eine Ikone verehrte, mit der Stimme des Präsidenten verband. Frau Wolfer nannte er nur ganz heimlich, in flüsternden Monologen, "Andrea"; es ihr einzugestehen war nicht vorgesehen, ja, Herr Krebs hätte es für überflüssig gehalten, da sie in seinen Vorstellungen doch davon wusste!
Wenn sie - selten genug - in der Kanzlei erschien, um ihren Gatten abzuholen, fühlte Herr Krebs ihren geheimnisvoll-leuchtenden, sanft wissenden Blick auf sich ruhen. Diese naturhaft-schöne, herbe Dame erinnerte ihn manchmal nebelhaft an seine zu früh verstorbene Mutter, die ihn von seinem Vater weggenommen hatte, einem kalten, beziehungsarmen Mann, der nach dem Tod der geschiedenen Gattin, als man den Sohn ins Waisenhaus brachte, aus der Stadt zog und sich nicht mehr sehen ließ. Kurz vor der Scheidung war Mutter noch aus der Kirche ausgetreten; Herr Krebs vermutete, um den Vater zu ärgern, der für einen Verein der Pfarrei die Buchhaltung führte. Obwohl Herr Krebs die kirchliche Welt, zu der sein Vater gehörte, bewusst ablehnte (schon um vermuteten Vorwürfen des Vaters zu begegnen, der frühe Tod der Mutter sei gewissermaßen eine Strafe für den Kirchenaustritt gewesen), spürte er einen Zusammenhang zwischen seiner früheren kindlichen Andacht zur Mutter Gottes Maria in der Kirche und seinem heutigen mystischen Verhältnis zu "Andrea".
Auf dem Gemälde an der Kanzleiwand schien diese Beziehung festgehalten. Man sah ein Liebespaar. Die Geliebte (sie glich "Andrea" auch äußerlich, wie Herr Krebs fand) hielt den Kopf des Geliebten wie eine Mutter an ihre Brust. Das Bild war eigentlich schlecht geeignet für eine Gerichtskanzlei; der längst verstorbene frühere Präsident, Dr. Wolfers Kunst liebender Vorgänger, hatte es ausgesucht. Als später Dr.Wolfer das Amt antrat, blieb das Gemälde, entgegen den Befürchtungen von Herrn Krebs, hängen, wahrscheinlich weil es, im Gegensatz zu den Gerichtswitzen des früheren Kanzlisten, von einer offiziellen staatlichen Institution, dem Kunstkredit, geliehen war. Herr Krebs war aber sicher, dass Dr. Wolfer der Sinn für die dargestellten Zärtlichkeiten abging; er hielt ihn für einen unsensiblen, oberflächlichen Mann, der auf äussere Machtentfaltung bedacht war. Die phantastischen Dimensionen, welche Gewähr für Herrn Krebsens Verbindung zu „Andrea“ boten, blieben dem Präsidenten gewiss verschlossen.
Herr Krebs wusste nicht, wie lange er sinnierend am Pult gesessen hatte, als er Lärm hinter der Kanzleitür hörte, aufgeregte Stimmen, ein wüstes Gepolter; fast gleichzeitig stürzten Uniformierte herein, Herr Binggeli und Herr Furrer, Polizeibeamte, die manchmal Schwerverbrecher zu den Gerichtsverhandlungen geleiteten. Im Türrahmen sah er nun auch Dr. Germann, den zweiten Staatsanwalt, dahinter, wie versteckt im Dunkel des Ganges, Frau Wolfer.
"Andrea!" rief Herr Krebs und stürzte an den Polizisten vorbei durch den Türrahmen, vorbei am verdatterten Doktor Germann, vor Frau Wolfers Füße, die er zu küssen versuchte, was ihm nicht gelang, da Frau Wolfer, mit Hilfe des Staatsanwalts, ausgewichen war. Dabei entglitt ihr ein Schuh, den nun Herr Krebs, zu Boden gefallen und halb knieend aufgerichtet, wie eine Monstranz umklammerte.
"Macht diesem unwürdigen Auftritt ein Ende!" befahl der aus einem Seitengang herbeigetretene Doktor Wolfer in voller Missachtung der Bedeutung des Augenblicks in Herrn Krebsens Lebenstragödie. Als Herr Binggeli dem Kanzlisten vorsorglich die Handschellen anlegte, suchte Herr Krebs den Blick von „Andrea“. Die Dame seiner Träume hatte sich von ihm abgewandt, während der von seiner Gattin umarmte Dr. Wolfer, der Präsident, ihn keines Blickes würdigte.
"Peter", hauchte Frau Wolfer auf die Schulter ihres Gatten. - "Du hast mich verraten, Andrea", murmelte Herr Krebs, als er von Binggeli und Furrer an dem in Befremden erstarrten Paar vorbei abgeführt wurde.
(Erstmals erschienen in der Literaturzeitschrift „Poesie“ 1985, Heft 2)