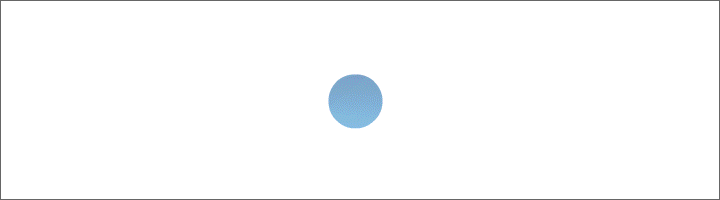Das Lachen in der Nacht
Von Felix Feigenwinter
Louis, ihr erster Ehemann, der ein Zyniker war, von dem sie sich scheiden liess, nachdem sie Bruno kennengelernt hatte - Louis also, der nie herzhaft gelacht, nur manchmal gegrinst hatte, zitierte genüsslich, was er irgendwann irgendwo aufgeschnappt hatte: Lachen sei die eleganteste Art, seinen Feinden die Zähne zu zeigen.
Daran musste Gisela denken, wenn Brunos Stimme aus der Kammer drang.
Bruno war kein Zyniker, und das Blecken seines ramponierten Gebisses, das sie sich vorzustellen versuchte, wenn sie sein einsames Lachen vernahm, schien Melancholie auszudrücken,Verzweiflung vielleicht, keinen Hochmut.
Manchmal brach sein Lachen aus seinem Schlafzimmer, das durchs Wohnzimmer von dem ihren getrennt war, durch sein offenes Fenster, und dann drang es von draussen durch ihr Fenster. Das geschah in der warmen Jahreszeit, während linden Frühlings- oder schwülen Sommernächten, und manchmal auch an Herbstabenden, wenn der Föhn die Stadt bedrückte. Eigentlich war es kein richtiges Lachen, eher ein heiseres Bellen. Es löste sich aus einem unbestimmten nächtlichen Dröhnen, und zuweilen war es kaum unterscheidbar vom durchdringenden Heulen aus irgendwelchen fremden Wohnungen oder vom Jaulen der Katzen, die durch die Vorgärten streunten. Nein, Brunos Lachen war alles andere als heiter; aber zunehmend befürchtete sie, dass es seine einzige Aeusserung sei, die sie nach zwanzigjähriger Ehe noch berühre.
Tagsüber war Bruno in einem Büro stationiert, das sich in einer Holzbaracke auf dem Gelände eines Güterbahnhofs am Rande der Stadt befand. Dort erledigte er Schreibarbeiten, füllte sachkundig Formulare aus; zwischendurch streunte er durch die zügigen Hallen des Güterbahnhofs, wo er Transportgüter aufspürte, die er für die Zollabfertigung bereitzuhalten hatte. Manchmal, auch wenn die Sonne brannte, es regnete oder schneite, ging er draussen durch die weiten Geleiseanlagen entlang den Güterzügen. Während den Arbeitspausen sass er in der Holzbaracke mit Berufskollegen zusammen, ass dicke Schinkenbrote und Essiggurken und trank Bier oder Wein. Es wurde viel Bier und Wein getrunken in der Baracke; es hiess, die Baräckler seien Alkoholiker.
Zu jener Nachtstunde lag Gisela noch nicht im Bett. Wie stets, nachdem sie abends in einem Restaurant in der Innenstadt gearbeitet hatte, benützte sie den letzten Bus, den sogenannten Lumpensammler, der späte Heimkehrer in die Aussenquartiere brachte. Wäre sie zuhause gewesen, hätte sie das Lachen kaum erreicht, denn es war Herbst; ein kühler, nasser Wind durchwehte die Stadt. Ihr Schlafzimmerfenster war geschlossen, und es wäre es bestimmt auch gewesen, wenn sie den Abend daheim verbracht hätte.
Das Lachen entwich dem einzigen offenen Fenster des Hauses, dessen Fassade im Schein der Strassenbeleuchtung an eine Theaterkulisse gemahnte. Vor ihr tauchte die schwankende Gestalt eines Betrunkenen auf. Sie erkannte Hansjörg Stöckli, einen Alkoholkranken, der im Nachbarhaus zusammen mit seiner betagten Mutter wohnte. Einen Augenblick lang erwog sie, umzukehren, in eine Nebenstrasse auszuweichen, durchs nächtliche Quartier zu schleichen, bis der unangenehme Nachbar verschwunden sein würde. Aber die Kälte der Herbstnacht durchsickerte ihre Kleider und griff nach ihren Eingeweiden. - Eines Morgens hatte sie Stöckli im kleinen Vorgarten entdeckt, wo er in einem Strauch sass, in den er offenbar gekippt war; hilflos umarmte er einen zerzausten Rosenstrauss aus einem Blumenladen. Sie hatte dem Sternhagelvollen auf die Beine geholfen und ihn zur Wohnungstür geführt, wo ihn die Mutter empfing; die alte Frau bedankte sich bei Gisela und entschuldigte sich für ihren Sohn; sie habe heute Geburtstag, erklärte sie und versuchte, den zerfledderten Blumenstrauss zu ordnen. - Jetzt, nach Mitternacht, schien Stöckli Gisela nicht zu erkennen. Als sie sich ihm näherte, knöpfte er die Hose auf und begann, enthemmt, wie er war, auf die Strasse zu pinkeln. Mit einem Sprung zur Seite verhinderte sie, vom Urinstrahl getroffen zu werden. Nun war sie nicht mehr bereit, sich um die tragische Figur zu kümmern.
Vorsichtig öffnete sie die Haustür. Sie drückte auf den rot leuchtenden Knopf, und sie stieg fast lautlos durchs matt beleuchtete Treppenhaus. Sie schlich in die Wohnung, vorbei am Kakteenfensterbeet, das Bruno einst eingerichtet hatte und das er immer noch regelmässig begoss. Durch den Türspalt erspähte sie die Dunkelheit, wo er sich versteckt hielt. Vorher, als sie auf der Strasse gegangen war, hatte Licht aus der Kammer geschienen. Vielleicht war Bruno im Bett noch wach gelegen und hatte ihre Heimkehr bemerkt; jetzt stellte er sich schlafend. Leise schaudernd ging sie weiter, vorbei am unbewohnten Kinderzimmer, dessen Türfalle sie sachte berührte, eine Gewohnheit, die ein verständnisloser Beobachter vielleicht als Verschrobenheit gedeutet hätte. (Bruno war diese Eigenart vertraut; er hatte sie zum erstenmal nach dem Auszug des Kindes aus der Wohnung wahrgenommen, und es hätte ihn beunruhigt, wenn Gisela eines Tages darauf verzichtet hätte.) Im Wohnzimmer öffnete sie die angelehnte Tür ihres eigenen Schlafgemachs. Sie stellte die Handtasche auf die Kommode und begann, die Kleider auszuziehen. Sie streifte das Nachthemd über, ging nochmals durchs Wohnzimmer ins Vestibül und durch die Küche zur Toilette; danach blieb sie in der Küche. Bestrahlt vom Neonlicht am Klapptisch sitzend, verschlang sie eine Bratwurst, die sie wie abwesend aus dem Kühlschrank geholt hatte, ohne die Holzschüssel mit dem Kartoffel- und Tomatensalat zu beachten, die daneben bereitstand.
Kurz darauf durchstreifte Bruno mit einem Pyjama bekleidet die Küche, um die Toilette zu erreichen. Wortlos wie ein Gespenst verschwand er, und Gisela betrachtete das zerfledderte Spinngewebe, das über dem geschlossenen Küchenfenster von einem rätselhaften Luftzug unaufhörlich leise durchweht wurde und an die sonst nackte Decke zitternde Schatten warf. Bruno kehrte zurück und blieb vor Gisela stehen. Nun starrte er auf den kahlen Teller, wo die Wurst gelegen hatte, und seine vorwurfsvollen Worte, die er deutlich auszusprechen versuchte, vermischten sich mit dem Rauschen sprudelnden Klowassers:
"Du hast die Wurst kalt gegessen, ohne Senf und Brot. Und den Salat hast du stehengelassen; die Kartoffeln und die Tomaten würden dir gut tun!"
Der Mann wirkte zerzaust, sein Gesicht war schattenbehangen, das Haar türmte sich zu einer wilden, wirren Mähne. Seine Alkoholfahne hätte Gisela überprüfen können, indem sie auf ihn zugegangen wäre und sich hätte küssen lassen; aber sie verzichtete darauf.
Als sie sich vor über fünfundzwanzig Jahren kennenlernten, spielte Bruno hauptberuflich Saxophon. Er war ein leidenschaftlicher, kein ausgebildeter Musiker. Mit seiner Band trat er an Hochzeiten, an Firmenanlässen und an Volksfesten auf, und dreimal wöchentlich spielte er in einem eher obskuren Nachtlokal, wo kein gediegenes Publikum verkehrte, wie sich Gisela erinnerte; vor allem Betrunkene hatten sich an Brunos Musik ergötzt. So war Gisela erleichtert, als er nach der Geburt der Tochter das Lotterleben als freischaffender Musikant mit einer Anstellung bei einer internationalen Transportfirma eintauschte; Brunos Eltern hatten auf dem Abschluss einer Berufsausbildung bestanden, und sie schienen beruhigt, ihren Sohn nun im Schosse eines etablierten Arbeitgebers beschäftigt zu wissen; "jetzt hast du eine gesicherte Existenz!", hatte der Vater frohlockt. Dem desavouierten Musiker entging indes keine Gelegenheit, zu beteuern, wie sehr er es hasse, ein Leben im Schraubstock führen zu müssen, wie er es nannte. Als Angestellter würde er langsam, aber sicher zum seelischen Krüppel, klagte er Jahre lang. Nachdem er auf dem Flohmarkt, gewissermassen demonstrativ, seine beiden Saxophone verschachert hatte, verfiel er immer mehr trotziger Eigenbrötelei.
"Du siehst schlecht aus", bemerkte Gisela nun mit kühler, sachlicher Stimme, und sie hätte noch beifügen können: "Du bist ein armer Tropf!", aber das hätte sie übertrieben gefunden.
Ohne seine absurde Nörgelei zu zerstreuen, verzog sich Bruno, mit der linken Hand unkontrolliert im Haar kratzend, und sie hörte, wie er seine Schlafzimmertür hinter sich schloss.
Gisela erhob sich. Sie zündete eine Zigarette an, deren Rauch sie einsog, während sie in der Küche hin- und herging. Später öffnete sie das Küchenfenster. Dort verharrte sie minutenlang. Durchs spärlich belaubte Baumgeäst erblickte sie am Rand der Hintergärten die Mauern von Nachbarhäusern; einige Fensterscheiben schimmerten. Eine Maueröffnung gab den Blick in eine gelb erleuchtete Kammer frei; zwei Gestalten umarmten sich reglos. Durch ein anderes Fenster leuchtete rotes Licht.
Nachdem sie ihr Schlafzimmer aufgesucht und sich ins Bett gelegt hatte, versank sie widerstandslos in Traumbildern, aber bald wurde sie durch schrilles Läuten geweckt. Sie angelte den Telefonhörer ans Ohr; es meldete sich Käthi. Das Gespräch dauerte kurz. Gisela hastete zu Brunos Schlafzimmertür, wo sie klopfte, polterte und rief, bis von innen geöffnet wurde. Infernalischer Gestank verschlug ihr den Atem; dicke, schweflige Luft ergoss sich durchs offene Fenster in die Schlafkammer, erfüllte diese schon restlos.
"Bist du bei Trost?!" schrie Gisela; "Käthi hat angerufen. Ein Chemieunfall! Die chemische Fabrik brennt! Und dein Fenster steht sperrangelweit offen!"
"Ich weiss", lallte Bruno schläfrig, und er tappte zum Fenster, um es zu schliessen, "ich habe die Sirenen gehört... Wir werden vergiftet."
"Komm raus aus diesem Gestank!", rief Gisela und drängte den Mann, die Türe hurtig zuzumachen. Durchs Vestibül schob sie ihn ins Wohnzimmer, und von dort zog sie ihn in ihre Kammer. "Hier stinkt es nicht so entsetzlich. Stell den Transistor an! Käthi hat gesagt, am Radio bringen sie ständig die neuesten Katastrophennachrichten."
So lauerten sie eng umschlungen in Giselas Bett, zwei verschüchterte Kreaturen, an die Grenzen ihres Daseins gedrängt. Erst, als der Morgen dämmerte, als die Angst allmählich wich, lösten sie sich aus der Umklammerung, misstrauisch durchs geschlossene Fensterglas in den nur fahl beleuchteten Garten spähend, wo ein verstörter Krähenschwarm einflatterte, sich auf den Baumgerippen versammelte; die belegte Stimme des Radiosprechers hatte soeben "Endalarm" verkündet.
Eine Stunde später verliessen Bruno und Gisela die Wohnung, traten zusammen in den düsteren Herbstmorgen. Vor dem Haus standen zwei Sanitätsautos. In einen dieser Wagen wurde eine Bahre getragen, auf der Frau Stöckli lag, Hansjörgs Mutter. Sie sei in der Nacht gestorben, sagte der Sanitäter, der den betrunkenen Sohn zum anderen Auto führte.
"Gottseidank ist Frau Stöckli erlöst worden", sagte Gisela, nachdem die zwei Transportautos weggefahren waren und das Ehepaar zur Bushaltestelle weiterging. "Sie konnte einem leid tun. Es war nicht mehr mitanzusehen!"
"Für den Sohn wird es nun schwierig", bemerkte Bruno; "ohne seine Mama!"
"Auch für ihn gibt's wohl eine Lösung", antwortete Gisela; "vielleicht wird er endlich erwachsen."
Im Bus, auf der Fahrt in die Innenstadt, sassen sich Gisela und Bruno gegenüber, eingepfercht im Gedränge schweigender Fahrgäste. Bruno bleckte stumm sein Gebiss.
Gisela lächelte.
(Diese Erzählung ist eine Ueberarbeitung des Textes "Katastrophennacht" aus dem Jahr 1989.)